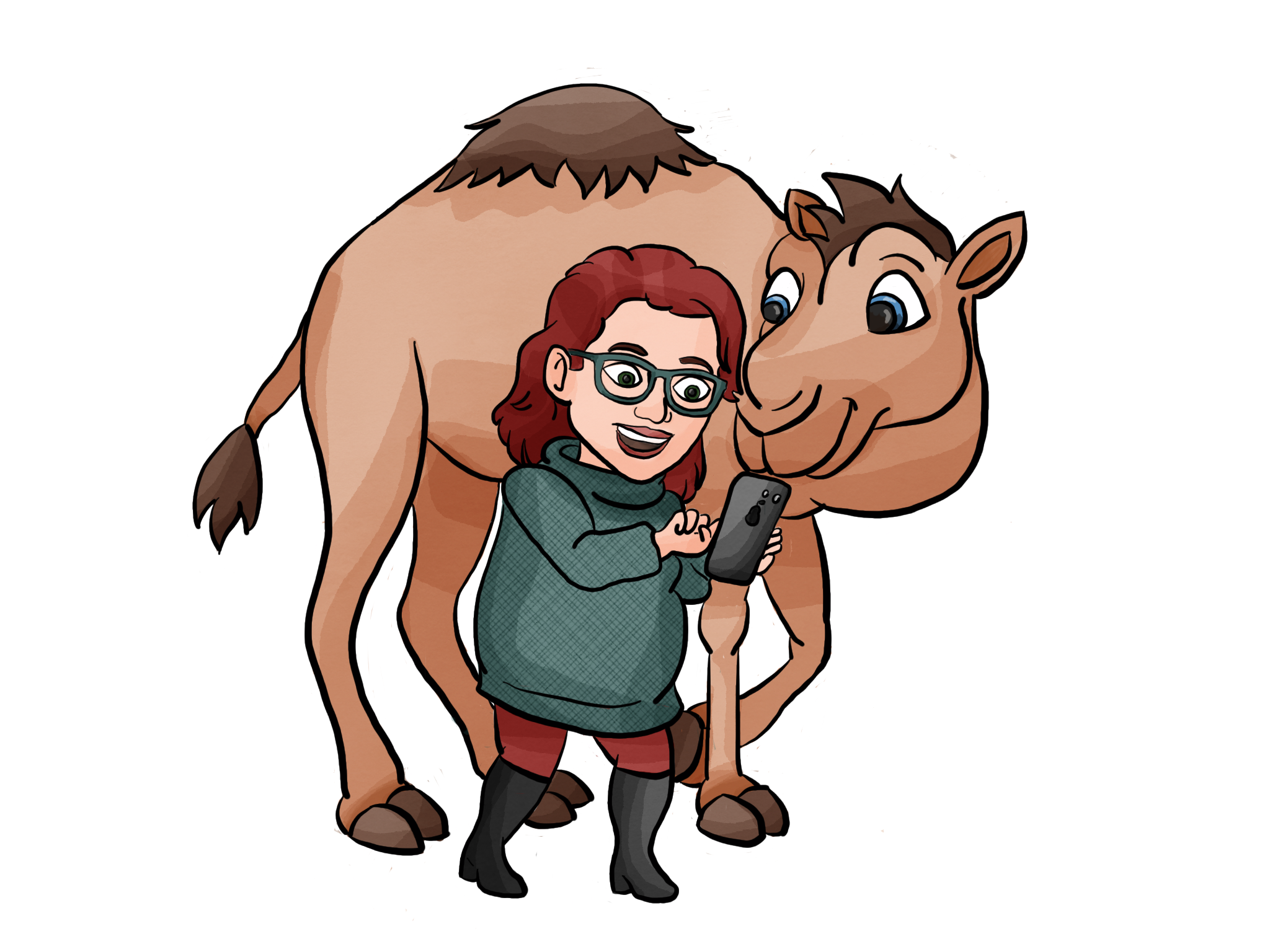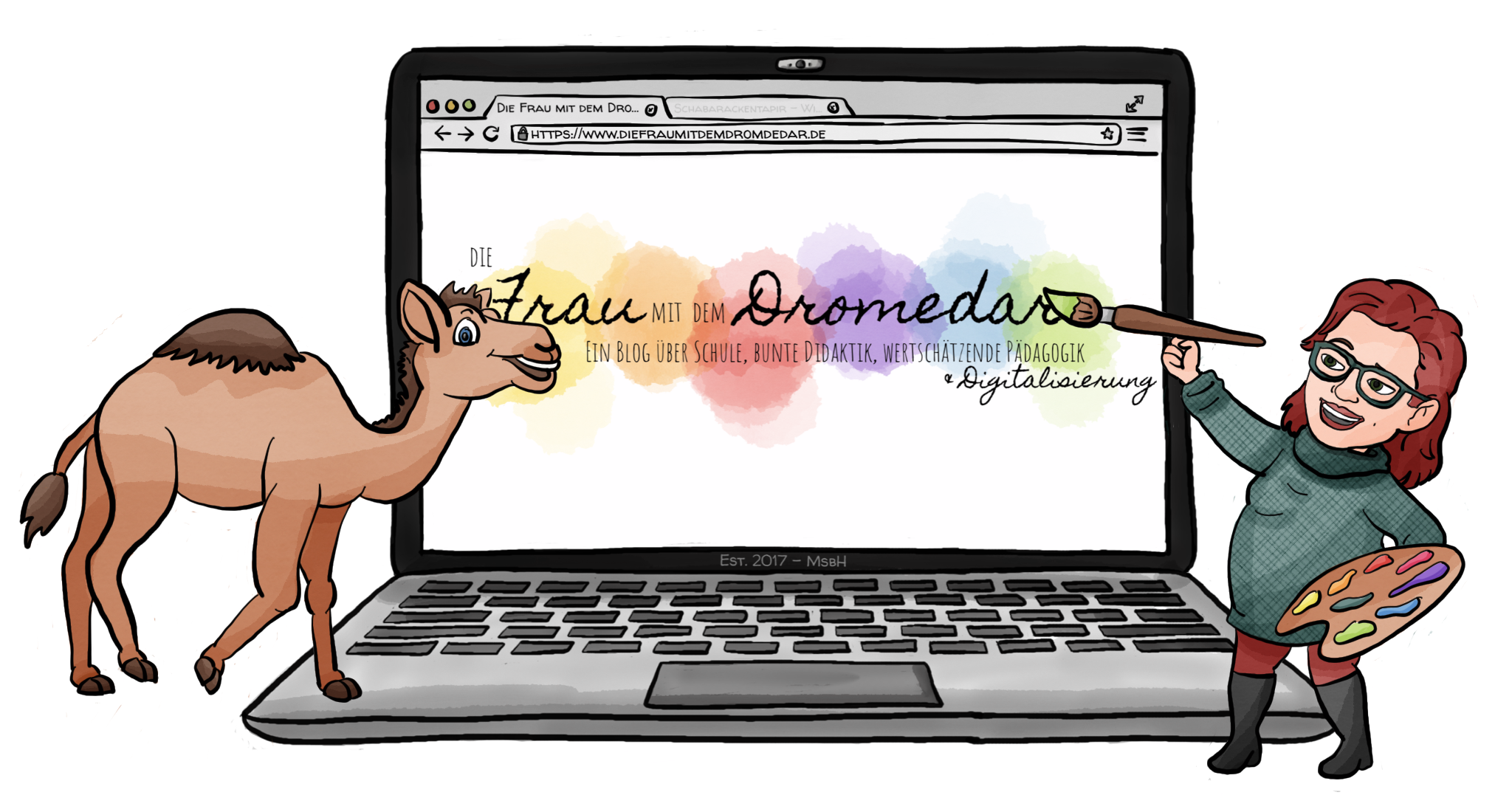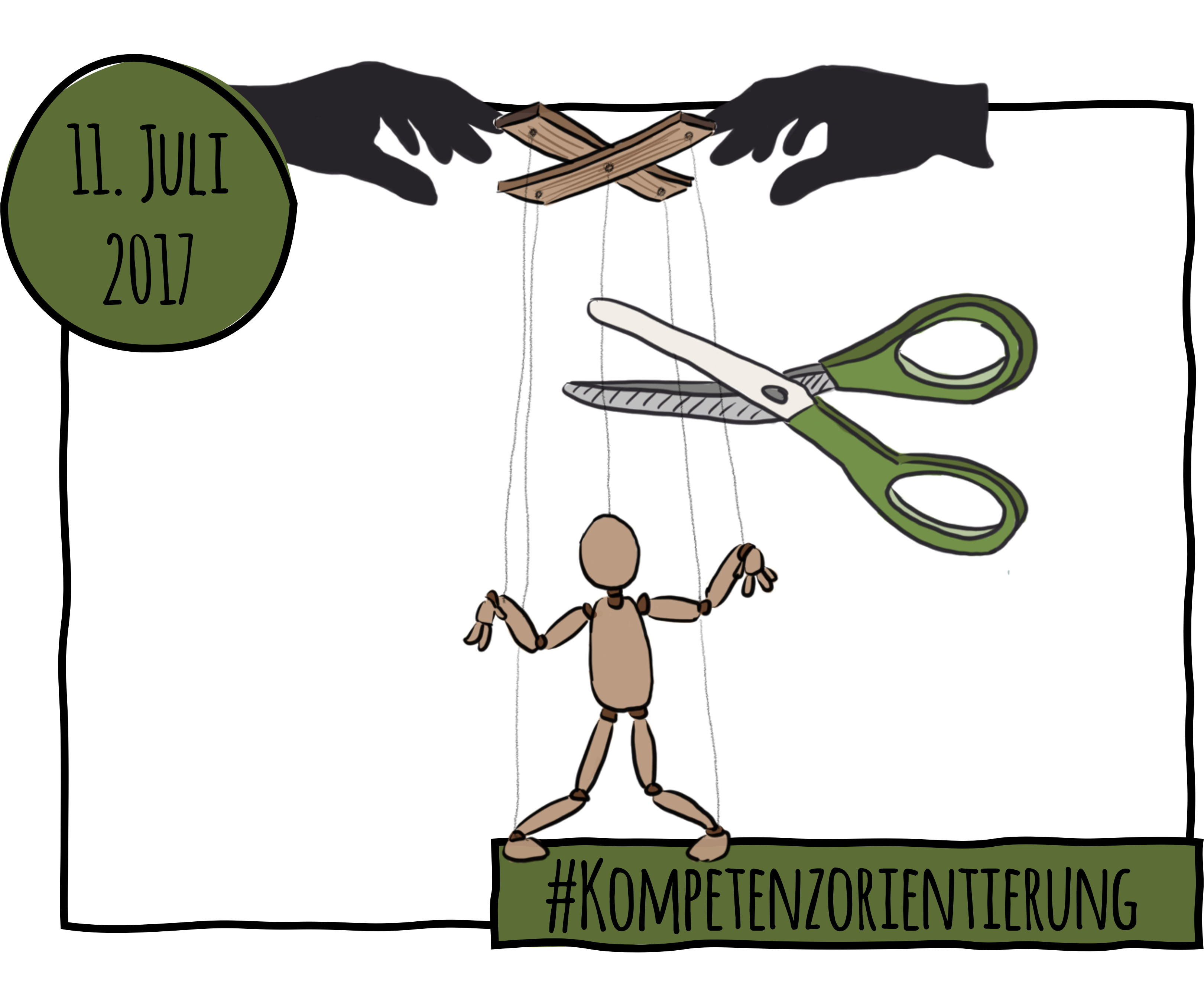Prolog in der Kompetenzhölle
In Bayern wird im September mit dem neuen Schuljahr der LehrplanPLUS eingeführt. Über allem schwebt wie das Schwert des Damokles, drohend und unheilverkündend, ein einziger Begriff, der die Fachschaften in Angst und Schrecken versetzt, die Kollegen dazu bringt, sich in Rage zu reden, der von Veränderung kündet, von Revolution gar – Zeit sich zu verstecken, Konserven zu horten und dem drohenden Untergang aus dem Panic Room ins Auge zu sehen. Nicht erschrecken, hier kommt er:
K – O – M – P – E – T – E – N – Z – E – N
Diesen Begriff in ein Lehrerzimmer zu werfen, fühlt sich bisweilen an, als hätte man laut „Voldemooooort“ geschrien, statt „Der, dessen Name nicht genannt werden darf“ zu flüstern, Unbehagen breitet sich aus, jene eisige Stille, die man sonst nur kennt, wenn der Kaffee ausgegangen ist und keiner neuen besorgt hat.
„Warum eigentlich?“, fragt meine unsägliche Naivität irgendwo zwischen dem „Pädagogischen Tag“, dem dritten Kaffee in Folge und der Frage danach, ob wir den Aufgabenpool für die zehnten Klassen wirklich schon in diesem Schuljahr angehen sollten, obwohl wir doch noch gar nicht wissen, was dann genau kommt. Ich erinnere mich an die güldenen Zeiten des Studiums, in denen ich den Begriff „Kompetenzen“ mit der Muttermilch der ersten pädagogischen, psychologischen und didaktischen Seminare einsog, ohne ihn in Frage zu stellen oder ihn gar zu fürchten. War das alles falsch? Hätte ich weglaufen sollen, solange ich konnte?
Bis zum September ist noch ein wenig Zeit, bevor ich weglaufe, breche ich also noch schnell eine Lanze für ein positives Verständnis des Kompetenzbegriffs. Bitte sehr:
Der Stein des Anstoßes
Kompetenzen werden – so mein Eindruck – vielfach verstanden als etwas vollkommen Neues, ihr Erwerb scheint alles über den Haufen zu werfen, was wir bisher Unterricht nannten. Erst heute im Lehrerzimmer hörte ich wieder einer kleinen Debatte zu, deren Gegenstand sie waren und das Fazit eines Kollegen lautete: „In diesem Schuljahr habe ich viele Lernziele erreicht. Kompetenzen allerdings nicht.“
Die didaktische Form, in der ich während des Studiums den Begriff der Kompetenz kennenlernte, war ihr vermeintlich größter Feind. Verehrte Leserschaft, erstarren Sie in Ehrfurcht: Der Lehrervortrag, in universitären Gefilden besser bekannt als die Vorlesung. Gerade in den Kreisen der Geschichtslehrer versetzt sein vermeintlich bevorstehendes Ende ganze Fachschaften in Erregung, seine angestaubte graue Eminenz scheint mit den letzten Kollegen, die ihn in Vollendung beherrschen, weil ihnen Tafel und Kreide einfach nicht genug waren, die Schulen zu verlassen, weil er scheinbar nicht in die schöne neue Welt aus Kompetenzen und Output, das Feuerwerk der Medien und Methoden passen will. Stattdessen, so scheint es, sollen an seine Stelle unkontrollierbare Freiarbeitsphasen, Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeiten treten, in denen sich der Lehrer als überflüssiges Individuum an den Wänden des Klassenzimmers herumdrückt und auf den Gong wartet. Das mag polemisierend wirken – keine Sorge: Das soll es auch.
Resultiert das Problem mit dem Kompetenzbegriff am Ende daraus, dass wir seinetwegen einsehen müssen, dass allein die Vermittlung traditionellen Bildungswissens dem Leben „da draußen“ nicht gerecht wird, auch wenn wir uns noch so sehr wünschen, dass Goethe, der Logarithmus, der Zitronensäurezyklus und der Prager Frühling die Schüler zu lebensfähigen Menschen machen? Ich will die Bedeutung des Wissens nicht negieren, gerade in Zeiten, in denen die Öffentlichkeit ein Aufschrei nach (politischer) Bildung durchzieht, in denen die Entzauberung von Alternativen Fakten und Fake News die Debatten prägen, wäre es falscher als falsch zu sagen, dass Schüler kein deklaratives Wissen bräuchten, weil das prozedurale genüge. Wissen ist die Voraussetzung für Können und verliert deswegen nicht seinen Wert. Vielmehr gewinnt es daran, wenn es nicht nur ausgespuckt, sondern angewandt werden soll – oder?
Damit sind wir bei einem weiteren Gegensatz angelangt, aus dem sich zahlreiche Befürchtungen rund um den Kompetenzbegriff nähren: Die Forderung nach Berücksichtigung des Erwerbs von Kompetenzen schürt die Befürchtung, dass dabei wichtige Inhalte verlorengingen, weil für sie keine Zeit mehr bliebe. Oder – mindestens genauso schreckenerregend – eine Beibehaltung der Inhalte bei gleichzeitiger Stärkung des Kompetenzerwerbs führe zu einer Überfrachtung der einzelnen Unterrichtsstunden, sodass weder das eine noch das andere adäquat geleistet werden könne. Für beide Eindrücke mag es berechtigte Anhaltspunkte geben, die zur Angst vor einer Überforderung durch die Neuerungen führen, die ich dennoch in diesem Maße nicht teilen will.
Wie ich den Begriff „Kompetenzen“ verstehe(n will)
Ich weiß nicht, wie der Kompetenzbegriff auf die bereits seit längerer Zeit Unterrichtenden gekommen ist, es scheint, als sei er von einem Postillon verkündet worden, der gleichzeitig die Hinrichtung durch den Strang qua königlichem Edikt angedroht hat, sollte er nicht genug Berücksichtigung finden. Deswegen möchte ich versuchen, ihn in meinen Worten zu erklären und ihm damit vielleicht ein wenig von dem Schrecken zu nehmen, der ihn umweht.
Als Konsens setze ich jetzt einfach mal voraus, dass der „Nürnberger Trichter“, das strikte Einfüllen von Wissen in das junge Gehirn, der Wissenserwerb qua „Handauflegen“, endgültig als Illusion klassifiziert ist und damit ausgedient hat. Wäre das möglich, wären wir überflüssig und bräuchten uns auch um die aktuell heißdiskutierten Schulabbrecherzahlen nie wieder den Kopf zerbrechen.
Auf den Kern reduziert, verstehe ich „Kompetenz“ in erster Linie als „tun können“ statt „Wissen ausspucken“, es ist das Ergebnis des – in meinem Verständnis – ureigensten Berufsinhalts des Pädagogen: Die Befähigung der Lernenden, Aufgaben zu lösen, nachdem sie darin angeleitet wurden und Übungsgelegenheiten erhalten haben.
Spätestens an dieser Stelle erwarte ich erleichtertes Aufatmen mindestens aller Mathematik-, Fremdsprachen-, Muttersprachen- und Sportkollegen, denn ist es nicht das, was wir die ganze Zeit schon tun? Es wird induktiv hergeleitet und erklärt, es wird geübt und anschließend sollen die Schüler die binomische Formel lösen, das Present Progressive richtig einsetzen, den Konjunktiv bilden oder den Basketballkorb nicht nur aus Zufall treffen.
Sind Kompetenzen wirklich so neu?
Was Kompetenzen (vielleicht) verändern
Kompetenzen zu vermitteln mag uns zunächst ein Stück weit von der ehrenvollen Tätigkeit der Wissensvermittlung entbinden, denn es ist ein Teil des Ganzen, den Schülern beizubringen, wie sie an Informationen kommen, sie auswerten, sie präsentieren, sie verwenden, um sich ein eigenes Urteil zu bilden, so dass das „Lexikon Lehrer“ an Bedeutung und damit die Aura des Allwissenden an Glanz verliert. Damit wird aber nicht der Unterricht zu einer glanzlosen Angelegenheit, nein, das Schwinden der Aura macht Platz für Erfolgserlebnisse jenseits der reinen Rezeptionsleistung des Zuhörens und Verstehens.
Im Gegensatz zu den ihm anvertrauten Schülern hat der Lehrer das Minimalziel schon erreicht: Auch wenn er wieder in die Schule zurückgekehrt ist, ist er in der Lage, sein Leben selbstbestimmt und unabhängig zu bestreiten (so die Theorie ^^), wozu die Kinder erst noch befähigt werden müssen, weswegen ihnen die Rolle des Zuschauers bei ihrem eigenen Lernprozess nicht gerecht werden kann.
Rufen wir uns vor Augen, wie eng die Freude von Schülern an einem Fach und seinen Inhalten damit verknüpft ist, dass sie wirklich verstehen und wissen, wie sie etwas lösen können – vielfach und doch viel zu selten ausgedrückt in dem begeisterten Satz „Hey, ich kann das!“: Gibt es etwas Schöneres als den Geistesblitz mitten in einer Stunde, die Beobachtung, dass jemand gerade sein eigenes Können entdeckt hat und sich daran erfreut?
Den Lehrer vom allwissenden Vermittler zum Trainer umzuwandeln und sein Wissen als Medium zeitlich begrenzt zu nutzen statt ihn als einzige, nie versiegende Quelle unendlicher Weisheit zur unabdingbaren Lernvoraussetzung zu machen, entbehrt zwar der Aura, entbindet aber auch gewisser schwer zu tragender Verantwortung: Weder muss er auf jede Frage eine Antwort wissen, noch muss sein Vortrag jedem Lerntyp und jedem Lernprozess angemessen sein, wenn er stattdessen geeignete Materialien seine Aufgaben übernehmen lässt, um die Prozesse zu initiieren statt das Denken für die Schüler zu übernehmen, wodurch er in die wenigsten Gehirne dauerhaft vordringen wird können.
Die Flut der Materialien, die uns im Zusammenhang mit neuen Lehrplänen präsentiert wird, führt zu einer weiteren Unsicherheit: Gerade wenn ganze Reihenplanungen, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, gemeinsam mit dem neuen Curriculum vorgestellt werden, kann schnell der Eindruck entstehen, dass der Lehrer diese übernehmen solle, um das Gelingen seines Unterrichts zu gewährleisten, weil er der Aufgabe andernfalls nicht gewachsen sein könnte. Gleichzeitig ist dies mit den elementaren Grundlagen der Didaktik eines jeden Fachs nicht vereinbar: Die Lehrkraft ist es, der die Aufgabe obliegt, die Inhalte, die Materialien, die Arbeitsaufträge so an die Lerngruppe anzupassen, dass diese einen Erfolg erzielen kann, weswegen sie keinesfalls ohne eingehende Prüfung, ohne Überlegungen weitreichender Natur, übernommen werden können. Diese Kompetenz der Förderung von Kompetenzen, die dabei von ihr verlangt wird, ist eine derart wichtige Aufgabe, dass sie niemals aus der Hand gegeben werden kann, weswegen auch der beste von Experten vorgelegte didaktische Vorschlag niemals einfach übernommen werden kann. Stattdessen fordert jeder einzelne von ihnen eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Anlage und seinen Zielen, der der Lehrer gewachsen sein muss, um guten Unterricht machen zu können. Seine Expertise ist also gefragter denn je – wenn auch in möglicherweise ungewohnter Hinsicht. Das sollten wir nicht vergessen, gerade deswegen, weil diese Prozesse der Anpassung von Inhalten an eine Lerngruppe mit zunehmender Erfahrung mehr implizit als explizit vollzogen werden.
Als ich mein Verständnis des Kompetenzbegriffs aufgeschrieben habe, musste ich unweigerlich an Maria Montessoris berühmtestes Zitat „Hilf mir, es selbst zu tun!“ denken, was mich zu dem Schluss kommen ließ, dass Kompetenzen nicht so neu sein können, wie man vermuten könnte. Ein Pädagoge, der seinen Beruf mit Freude ausfüllt und sich nicht im Klassenzimmer langweilen will, sollte doch ein ureigenes Interesse an kompetenten Schülern haben. Hätte er dies nicht, diente der Klassenraum schließlich nur als Bühne der eigenen Bedürfnisbefriedigung und ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das diplomatisch schönreden sollte, erst recht, wenn ich darüber nachdenke, wie frustrierend es ist, Klassenarbeiten zu korrigieren, wenn man das Gefühl hat, dass man als Lehrer noch mehr für ein erfolgreiches Abschneiden des „Publikums“ hätte tun können.
Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann waren gerade die Momente, in denen man sich als Schüler gemeinsam mit einem Lehrer über das eigene gute Abschneiden, also das eigene Können, freuen konnte, Glanzlichter. Bedenken wir, dass diese schon eine Weile zurückliegt und ich das auch für Lehrkräfte sagen kann, die mittlerweile schon längst im wohlverdienten Ruhestand sind, dann kann es beim besten Willen nicht sein, dass „Kompetenzen“ erst gefördert werden sollen, seit es Lehrpläne vorschreiben.
Ein nie endender Hürdenlauf
Damit sind wir bei einem Kernproblem der Kompetenzvermittlung durch Lehrende angelangt: Den Kompetenzerwerb von Schülern zu fördern bedeutet, die nicht zu unterschätzende Aufgabe zu meistern, den Weg, der die Schüler zu einem gelungenen „Output“ führt, immer wieder mit der jeweiligen Lerngruppe neu beschreiten zu müssen und dafür ein ums andere Mal Hürden zu entdecken, die größer oder kleiner als beim letzten Mal auftauchen oder die vielleicht noch nie zuvor auf der Strecke zu finden waren.
Dabei gilt es nicht nur, von außen zu betrachten und anzufeuern. Vielmehr muss der Lehrer als Trainer bei zahlreichen Hürden eine Strategie bereitstellen, die ihre Überwindung fördert – und das obwohl er die Hürden selbst bereits vor Jahren oder Jahrzehnten überwunden hat, wodurch die Erinnerung daran, was ihm dabei geholfen hat, sie zu überspringen, bereits verblasst ist und ihn möglicherweise im Stich lässt, sodass er die Hürden immer wieder neu denken und vielleicht sogar selbst auf die Bahn muss, um sich an die Strategie zu erinnern.
Um gemeinsam ins Ziel zu kommen und dem Stolpern oder der fehlenden Kondition auf der Zielgeraden entgegenzuwirken, muss also alles getan werden, und zwar nicht im Sinne einer Verkürzung der Strecke. Im schulischen Kontext formuliert: Eine schwerwiegende Frustration auf beiden Seiten kann nur dann verhindert werden, wenn die Schüler kompetent genug sind, die an sie gestellten Aufgaben in einer Prüfung zu lösen.Gleichzeitig ist es keine Option, die Hürden eines Tests zu stutzen statt Strategien zu vermitteln, denn das Gefühl, von vergleichbaren Anforderungen abrücken zu müssen, kann als mindestens genauso negativ empfunden werden wie eine große Anzahl schlechter Noten aufgrund der mangelnden Lösbarkeit.
Kompetenzen zu fokussieren, sich auf das Können der Lernenden zu konzentrieren, bedeutet also auch, dem Scheitern frühzeitig durch die Vermittlung von Strategien entgegenzuwirken. Wer sie negiert und dies damit begründet, dass die Korrektur von Prüfungen durch die Berücksichtigung von Fähigkeiten, die nicht so einfach „abhakbar“ sind wie deklaratives Wissen, vernachlässigt den Umstand, dass beispielsweise das Bedürfnis, gelungene Darstellungen durch die Vergabe von Extrapunkten zu würdigen und bei Vernachlässigung von Zusammenhängen ein Haar in der Suppe für den Punktabzug zu suchen, bei jeder Arbeit mitkorrigiert, auch wenn man sich eigentlich eine „schnelle und leichte“ Korrektur gewünscht hat. Kompetenzorientiertes Korrigieren mag anstrengend wirken, trägt aber genau diesem Umstand Rechnung, dass ein engagierter Lehrer an der Präsentation von Fakten, die zwar korrekt sind, deren Zusammenhang aber dürftig ist und mangelndes Verständnis zeigt, keine rechte Freude empfinden kann.
Gleichzeitig sind gerade die Erhebungen von Kompetenzen besonders gute Indikatoren für die Messung von Lernerfolg – vor allem in den sogenannten „Lernfächern“. Während Schwächen in der Reproduktion immer auf einen schlechten Tag oder mangelnde häusliche Vorbereitung (kurzfristig) zurückgeführt werden können, weswegen auch „Einserschüler“ mal eine schlechte Leistung produzieren, können Kompetenzen hinsichtlich ihrer Verbesserung überzeitlich bewertet und damit die individuelle Bezugsnorm besser in den Blick genommen werden.
Ich wage ein Fazit
Dieser Beitrag stellte zu Beginn – und das ist eigentlich viel zu polemisch und wird meiner Einschätzung nicht gerecht – den Lehrervortrag allen anderen didaktischen Formen gegenüber und degradiert ihn zu einer Unterrichtsform längst vergangener Zeiten, als man in der Pause noch brav in Zweierreihen über den Hof laufen musste. Deswegen möchte ich an dieser Stelle klarstellen: Ich hätte den Lehrervortrag beliebig durch viele andere Methoden und Sozialformen ersetzen können, denn jedes Mittel, mit dem den Schülern während des Unterrichts das Denken abgenommen wird, hat nichts mit Kompetenzorientierung zu tun und negiert nachgerade den Grund, aus dem sie in der Schule sind: um zu lernen.
Stattdessen möchte ich dafür plädieren, den Lehrervortrag als ein Medium zu begreifen, mit dem gearbeitet werden kann. Man sollte ihn ebenso wenig unkommentiert stehen lassen wie einen Film, einen Text oder ein Bild, sollte mit ihm arbeiten, ihn als Ausgangspunkt für Arbeitsaufträge und Vertiefungen nutzen. Dann nämlich kann er sein volles Potenzial entfalten: Während Bild, Text und Film zum Schweigen verdammt sind, weil sie ohne ihren Autor im Gepäck daherkommen, ist der Urheber des Vortrags verfügbar und kann interaktiv in den Dialog im Klassenzimmer eintreten, um gewinnbringend zu wirken.
Lassen wir den Kompetenzbegriff zu und geben wir ihm eine positive Konnotation statt uns vor den Anforderungen zu fürchten, die er mit sich bringen wird. Es war meine Absicht, einen Artikel zu schreiben, von dem ich glaube, dass ihn zahlreiche Kolleginnen und Kollegen abwechselnd mit „Wer macht denn sowas?“ (den Schülern das Denken abnehmen, „pädagogischer Trichter“) und „Mache ich doch schon längst!“ (Schülern auf dem Weg zur Prüfung helfen statt ihnen die Hürdenstrecke hinzustellen und „Spring!“ zu rufen) kommentieren werden. Was einen guten Lehrer ausmacht, sind professionelle Eigenschaften und Handlungen, die ausdauernder sind als Lehrpläne und Begrifflichkeiten: Ein Interesse daran zu haben, dass Schüler etwas KÖNNEN, wenn sie die Schule verlassen, ist unabhängig davon, ob man dies als Kompetenz bezeichnet oder als „gewusst, wie“. Sie zum Lernen anzuregen, ihnen eigene Fehler als Lerngelegenheit aufzuzeigen, zu wollen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden, urteilen können, selbstständig Wissen erwerben, es anwenden – ganz einfach dass sie ihren Weg machen – das braucht keinen Fachbegriff, um es fördern zu wollen.
Nehmen wir den Begriff der Kompetenz, all seine fachlichen Ausdifferenzierungen, die Anregungen aus der Didaktik und machen wir das damit, was wir am besten können: Gestalten wir Lernprozesse, die den Kindern helfen, die ihnen Erkenntnisse ermöglichen, die sie bestenfalls „lebensfähig“ machen. Lasst uns das Auftauchen dieses ungeliebten Begriffs nutzen, um uns gelegentlich die wichtigste Frage zu stellen: War das, was wir miteinander gelernt haben, geeignet, um sie die Prüfungen bestehen zu lassen, die ich ihnen stellen muss, damit sie das lernen, was sie sollen, um in der Welt und all ihren Systemen zu bestehen? Denn daran wird man dich messen.
Zurück zum Anfang mit Aussicht auf Nachschulisches
Kommen wir zurück zum Kontext der Universität und der guten alten Vorlesung: Auch wenn ich den Lehrervortrag nicht so effektvoll beherrsche wie manche Kollegen, die ich dabei schon bestaunen durfte, möchte ich festhalten, dass diese Methode doch gerade die ist, die den Lernenden die meisten Kompetenzen abverlangt – zumindest, wenn sie in ihrer Reinform, der Vorlesung, umgesetzt wird. Denn das Bestehen der mit ihr in Zusammenhang stehenden Prüfung bedarf der Eigeninitiative, der Nachbereitung, dem aktiven Tun und Beitragen zum eigenen Lernerfolg – kurz eines massiven Konglomerats an Kompetenzen der Lerner, dass der Lehrer, der die Studierenden kurz zuvor zum Abitur geführt hat, nur mit den Ohren schlackern kann.
Gestatten wir also unseren Schülern in der Schule eine Zeit des Lernens, in der sie vorrangig die Kompetenzen erwerben, die das Erdulden des Lehrervortrags in über das Gymnasium hinausreichenden Bildungseinrichtungen voraussetzen.Geben wir den Professoren einen Grund weniger, sich über die mangelnden Fähigkeiten der Studierenden zu beschweren. Machen wir die Schüler zu kompetenten Studenten, die wissen, was jenseits der Vorlesung zu tun ist, um die Prüfungen, die wir nicht mehr stellen werden, zu bestehen. Die Begeisterung für ein Fach zu wecken, beständig zu halten und zu vertiefen, können wir dann getrost den Professoren überlassen, denn auch sie sind Teil der Masse der Lehrenden, die ihr Publikum mit den geeigneten Methoden für sich einnehmen können. Dass ihre Saat auf fruchtbaren Boden fallen möge, ist umso wahrscheinlicher, wenn unsere Schüler nicht nur das „Wissen, was“, sondern auch das „Wissen, wie“ und den Mut, es anzuwenden, mit ins Leben nehmen.
Lizenzhinweis
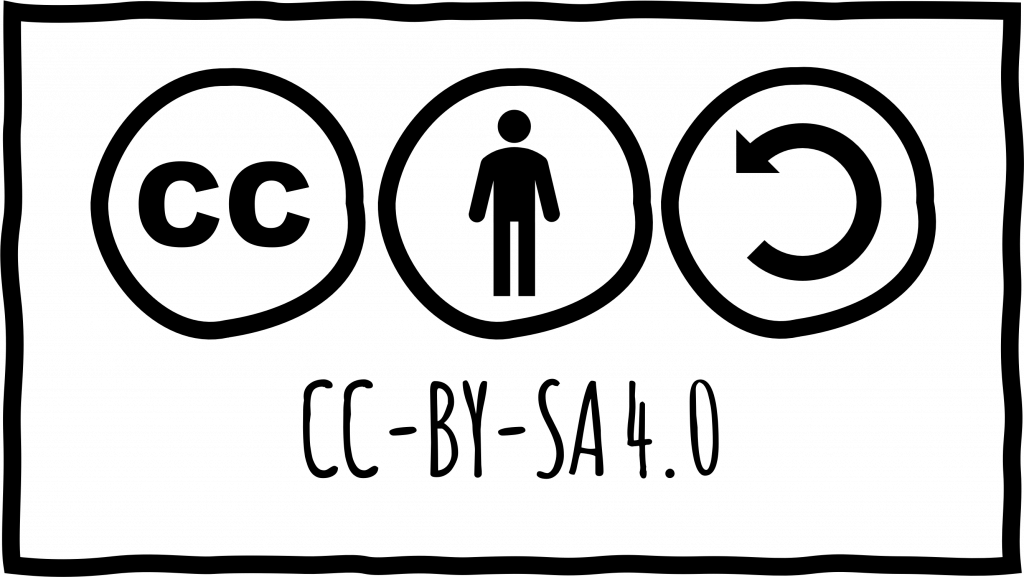
Dieses Werk von Kristina Wahl (diefraumitdemdromedar.de) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.