Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Konstantinos Kavafis: Ithaka
„Brichst du auf gen Ithaka, wünsch dir eine lange Fahrt, voller Abenteuer und Erkenntnisse.“ – So beginnt Konstantinos Kavafis‘ Gedicht „Ithaka“. Unweigerlich mit den Irrfahrten des Odysseus verknüpft, könnte man meinen, es gehe darum, endlich anzukommen. Aber statt zu mahnen, die Segel richtig zu setzen und den Wind zu nutzen, um in die schnell in die Heimat zu gelangen und nicht Zyklopen oder Poseidon fürchten zu müssen, empfiehlt das lyrische Ich, sich eine lange Fahrt zu wünschen, viele Städte zu besuchen, zu lernen und sich nur nicht zu beeilen.
Vielen dürfte das Gedicht – wenn überhaupt – aus einer Auto-Werbung, die vor einigen Jahren lief, bekannt sein. Mich dagegen hat dieser Text auf vielfältige Weise eingeholt. Vor allem, weil meine eigene Odyssee gerade zu einem Ende gekommen ist: Während es im Regelfall vom Beginn des Referendariats bis zur festen Planstelle zwei Jahre dauern sollte 1, hat mich die Nachricht, wo ich denn nun beruflich ankommen darf, Mitte Dezember und damit ganze 8 Jahre und 3 Monate nach dem Datum, das offiziell für mein „Jubiläumsdienstalter“ festgesetzt wurde, nach sechs verschiedenen Schulen und vier unterschiedlichen Schularten erreicht. Das muss ich erstmal verdauen. Wo schaltet man den Wandermodus eines Gehirns ab? Gibts da ’nen Schalter?
Natürlich bin ich erleichtert: Vorbei das Bangen, ob die Sommerferien bezahlt werden. Vorbei die Zeiten, in denen fachfremder Unterricht mehr als die Hälfte meiner Deputatsstunden ausmachte. Vorbei die Zwangsumzüge. Yay!
Aber: Vorbei sind auch die Zeiten, in denen mich schon alleine ein jeder Neuanfang und jedes vorherige Ende etwas gelehrt hat. Vorbei das automatische Kennenlernen von einer Menge toller neuer Leute. Vorbei das berufliche Nomadentum mit all seinen Erfahrungen. Was mach ich denn jetzt mit dem Dromedar? Das kann ich doch nicht einfach aufs Altenteil schicken!

Natürlich kam mir zu keiner Zeit der ernsthafte Gedanke, diesen Blog einzumotten, schließlich hat er mich seit dem Beginn meiner Wanderschaft begleitet und immer wieder, gerade dann, wenn es mal nicht so lief, wie erhofft, daran erinnert, was ich bisher schon alles ausgetüftelt und ausprobiert habe. Stattdessen habe ich ihm pünktlich zum neuen Jahr 2024 ein großes Makeover verpasst. Die Optik ist neu, die Struktur ist neu und das frisch installierte Dromedar-LMS wird in naher Zukunft auch gefüttert werden. Denn so wird es möglich sein, Lerneinheiten aus mehreren Kapiteln, die ich auf Mebis entwickle, auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Den Anfang macht natürlich eine Revolution… wie passend.
Bevor das aber so richtig Fahrt aufnimmt, will ich die Gelegenheit nutzen, die Odyssee Revue passieren zu lassen. Denn während es hier auf dem Blog in den vergangenen Jahren vor allem Unterrichtsmaterialien für den ganz konkreten Einsatz gab, ist so viel passiert, habe ich so viel gelernt, worüber es sich lohnt, zu schreiben.

Bevor ich begonnen habe, diesen Post zu schreiben, habe ich in alten Bildern gestöbert. Ein bisschen Zeitmaschinenfeeling kann ja nicht schaden. Aber ich will keinen Rückblick in Anekdoten schreiben. „Menschen – Bilder – Emotionen“ können die im Fernsehen auf der großen Bühne deutlich besser. Als ich den Titel für den Beitrag gewählt habe, habe ich mir natürlich den Spaß gegönnt, ihn ein bisschen Clickbait-konform zu formulieren. Aus Seriositätsgründen muss ich ihn wohl doch ein bisschen anpassen:
5 Dinge, die ich als Gymnasiallehrkraft nicht gelernt hätte2
- Schule ist (auch nur) Arbeit.
- Der Lehrplan ist egal.
- Wir sollten uns Hauptschulen zum Vorbild nehmen.
- Um die Demokratie zu verteidigen, braucht es die Schulen.
- Bildung ist keine Dienstleistung.
Ding 1: Schule ist (auch nur) Arbeit.
Es mag nur auf anekdotischer Evidenz beruhen, aber in meinem Umfeld sagen die wenigsten Lehrkräfte „Ich gehe arbeiten“, viel öfter höre ich „Ich gehe in die Schule.“ Das mag zutreffend, bisweilen sogar präziser sein, ist aber mit einer anderen Beobachtung verbunden: Wir sprechen häufig über Arbeit, vor allem dann, wenn wir zu viel davon haben. Über Arbeitsschutz sprechen wir dagegen selten. Dass ich mir mittlerweile über Pausen-, Ruhe- und Maximalarbeitszeiten ebenso Gedanken mache wie über Lautstärkebelastung, ist eine Errungenschaft aus meiner Zeit an der Privatschule, die auch eine Wirtschaftsschule war.
Während man an Gymnasien vergleichsweise selten auf Menschen trifft, die vor dem Lehramt mal einen „echten“ Beruf hatten, also einen in DER WIRTSCHAFT [sic!], war das dort für alle, die Wirtschaftsfächer (Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle, Übungsunternehmen) unterrichten wollten, quasi das Pflichtprogramm vor der Schule gewesen. Weil für uns ein ähnliches Vertrauensarbeitszeitprinzip3 galt wie an staatlichen Schulen, war es natürlich genauso notwendig, sich gerade in Korrekturhochphasen vor Überlastung zu schützen. Dass dieser Schutz nicht nur ein Nice to have, sondern gutes Recht ist – mühsam von Gewerkschaften seit der Industrialisierung erkämpft – das haben mir meine Kolleg*innen immer wieder vor Augen gehalten.

Während also in der Presse die Kombattanten darum ringen, ob die Viertagewoche das Land vor dem kollektiven Burnout oder die 40-Stunden-Woche die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahrt, kann ich auf einer ganz persönlichen Ebene sagen, dass die aus unseren Unterhaltungen über Arbeitsschutz folgende Arbeitszeiterfassung mich weitergebracht hat. Sah es anfangs noch danach aus, als würde es mich mehr stressen, wenn ich durch die eindeutigen Zahlen irgendwann die Tastatur fallenließe, um mich in den Feierabend zu retten, merkte ich schnell, dass es auch entlastend war, die mangelnde Unterrichtszeit nicht mehr durch ausufernde Vorbereitung zu kompensieren. Realistischer sind seither nicht nur meine Erwartungen an mich selbst, sondern auch die an meine Schüler*innen.
Ding 2: Der Lehrplan ist egal.
Auf das zweite Ding trifft die Überschrift wahrscheinlich am allermeisten zu, denn das der Lehrplan doch eigentlich wurscht ist, hat mir am Gymnasium noch niemand gesagt. An der Mittelschule schon. Und zwar nicht unter der Hand, an der Kaffeemaschine im Lehrerzimmer, wo man sich gegen Schuljahres- und Nervenende trifft, um durch gemeinsames Jammern ein bisschen Psychohygiene zu betreiben, indem man sich gegenseitig erzählt, was man bis zu den Sommerferien alles nicht mehr schaffen wird. Sondern von „oben“. Von Seminarlehrern! *hier Skandal-GIF einfügen*
Auf einer offiziellen Informationsveranstaltung für die neuen Lehrkräfte, die von anderen Schularten an die Mittelschule wechselten, war das eine der ersten Informationen, die man uns gab: Der Lehrplan sei nicht darauf ausgelegt, ihn vollständig zu bewältigen. Vor allem nicht in den Nebenfächern, da solle man sich darauf einstellen, dass man jeweils ein Themenfeld nicht schaffen werde und dementsprechend die Lernbereiche auswählen, die man für die Lerngruppe am interessantesten bzw. für am besten geeignet erachtete.
Frisch aus dem Referendariat kommend war das damals für mich etwas Unerhörtes, denn da war es immer darum gegangen, dass man am Ende den Lehrplan geschafft haben müsste. Stundenlang hatten wir uns, auch in Fachsitzungen, den Kopf über didaktische Reduktion zerbrochen, also darüber, wie wir in zwei Stunden Geschichtsunterricht pro Woche möglichst viel Historie in die Kinder hineinbringen würden, ohne dass in Anbetracht der für die Vermittlung notwendigen Methoden zu viel Fachlichkeit auf der Strecke bliebe. Und das sollte jetzt alles nicht mehr gelten? An was für einer Anarcho-Schulform war ich denn da gelandet?
Diesen Gedanken sacken zu lassen, war erstmal gar nicht so einfach, schließlich war ich in meiner Klasse gleich für fünf Fächer verantwortlich, von denen ich die meisten noch nie unterrichtet hatte. An was hätte ich mich denn klammern sollen, wenn nicht an den Lehrplan? Mit ein bisschen Erfahrung in diesem neuen Arbeiten merkte ich allerdings, dass es ohne diesen Ratschlag gar nicht ging, wenn ich manchmal den ganzen Tag, die vollen sechs Stunden mit meiner Klasse verbrachte. Damit verbunden war ein völlig neues Zeitgefühl, denn auch der Stundenplan war letztlich nur eine Empfehlung. Wenn Mathe mal länger dauerte, machten wir länger Mathe. Und wenn es zu viel des Inputs war, dann musste ein Spiel her oder eine Kunst-Einheit, in der andere Talente gefragt waren.
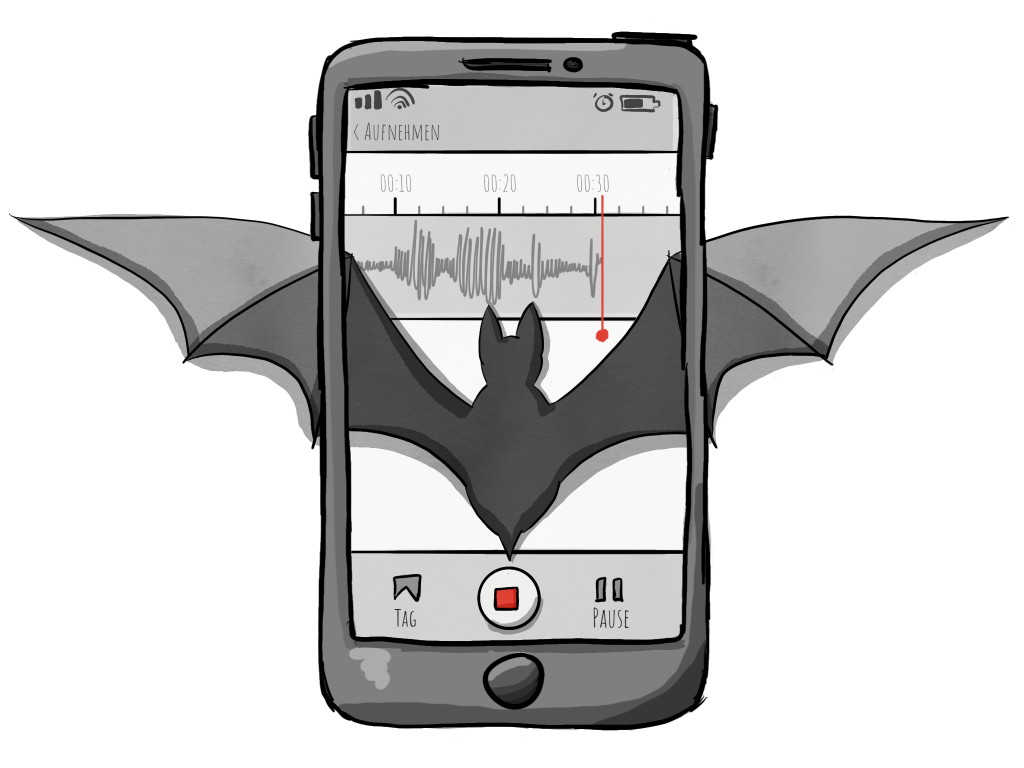
Das beste Beispiel dafür, dass sogar Deutsch länger dauern kann, ist das Gruselhörspiel-Projekt, über das ich auch hier auf dem Blog geschrieben hatte: Drei Stunden am Stück schrieben die Kinder damals an ihren Erstentwürfen – weil sie die Aufgabenstellung und die Aussicht darauf, gemeinsam eine Geschichte aufzunehmen, motivierte. Sie lernten dabei eine ganze Menge. Und ich lernte, dass es unfassbar wichtig ist, dass sie etwas lernen – dass es für die Nachhaltigkeit dieses Lernens aber eine andere Form von Bedeutung braucht als allein die, dass sie es laut Lehrplan lernen sollen. Gerade dann, wenn keine formalisierte Prüfung bevorsteht, ist es so wichtig, einen Bezug zu schaffen, der darüber hinausgeht.
Natürlich ist es auch heute nicht egal, was die Schüler*innen in meinem Unterricht lernen. Aber die Freiheit, Schwerpunkte so zu setzen und Methoden so zu wählen, dass es ihnen möglichst leichtfällt, sich an ihre Aufgaben zu machen, ist unfassbar wertvoll und ich nutze sie, wann immer es geht. Diese Erkenntnis habe ich mitgenommen und sie hat meine Perspektive nachhaltig geprägt. So sehr, dass ich nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Bereichen behaupten würde:
Ding 3: Wir sollten uns Hauptschulen zum Vorbild nehmen.
Dass ich hier den Begriff „Hauptschule“ benutze, ist volle Absicht, denn natürlich heißen die Hauptschulen in Bayern schon lange4 nicht mehr so. Der Begriff ist häufig mit einer negativen Grundhaltung verbunden, aber genau diese Provokation, sich eine vielfach totgesagte Schulart zum Vorbild zu nehmen, ist mehr als beabsichtigt.
Als ich neulich auf einer Fortbildung war, bei der es um die regionalen Aktivitäten rechtsextremistischer Kleinparteien ging5, sprach eine der Referentinnen, ebenfalls Gymnasiallehrerin, genau das an: Dass sie im Kontakt mit Lehrkräften der Mittelschulen häufig den Eindruck gewinne, dass man dort weiter sei, was die politische Bildung beträfe, weil es dort besser gelänge, die alltäglichen Geschehnisse in den Unterricht einzubinden. Das entspricht auch meinen Erfahrungen. Und gerne will ich an dieser Stelle erklären, was die Ursachen dafür sind, dass das an anderen Schularten nur selten bzw. deutlich schwerer gelingt:
Dass es an den Mittelschulen ein Klassen- und kein Fachlehrerprinzip gibt, ist auf den ersten Blick eine banale Geschichte. Dass das – wie oben erwähnt – bedeutet, dass du halt gegebenenfalls einfach mal alle Fächer in deiner Klasse unterrichtest, außer Religion, wenn du keine Missio Canonica hast, oder die „praktischen Fächer“ wie Technik oder Ernährung und Soziales, wofür die Fachlehrkräfte zuständig sind, hat allerdings schon ein paar ehemalige Gymnasialkolleg*innen von mir gedanklich aus den Latschen gehauen. Dass das zur Folge hat, dass es an vielen Tagen komplett in den Händen der Lehrkraft liegt, wie die Zeit zwischen den Pausen strukturiert ist, erscheint mir, wo ich (wieder) an einer Schule mit Einzelstundenprinzip mit Zwischengong angelangt bin, mittlerweile selbst wieder wie eine Erfahrung von einem anderen Planeten.
Im Vorbereitungsdienst der Mittelschulen lernt man deswegen eine hohe Kunstform: Die Rhythmisierung, also die den Ressourcen der Lernenden möglichst angemessene Gestaltung eines langen Unterrichtsvormittags. Dazu gehören beispielsweise das Abwechseln zwischen Input- und Arbeitsphasen, theoretischen und praktischen Aufgaben und die Einbindung von spielerischen Methoden oder dem Verlassen des Klassenzimmers für einen kleinen Unterrichtsgang. Im Fachlehrerprinzip bleibt davon meist nur „Für die sechste Stunde brauche ich nicht so viel einplanen wie für die erste, da sind sie ja meistens schon nicht mehr so aufnahmefähig.“
Neben dieser Rhythmisierung kommt der Beziehungsarbeit eine immens wichtige Rolle zu, denn viele der Schüler*innen haben zuhause schwierige Bedingungen und sie können nur dann überhaupt lernen, wenn man ihnen mit Verständnis begegnen kann6. Einerseits gelingt das natürlich umso besser, je mehr Zeit man miteinander verbringt. Andererseits – und damit sind wir wieder beim Eindruck der Kollegin – spielt es aber halt auch eine wichtige Rolle, Schule nicht zu einem realitätsfremden Raum zu machen, in dem alles, was gerade nicht im Lehrplan steht, auch keinen Platz hat.
Schon an der Privatschule habe ich wieder im Fachlehrerprinzip gearbeitet. Aber auch dort gab es Punkte, die die Beziehungsarbeit erleichtert haben: Lehrkräfte, gerade in den Kernfächern, wurden, wann immer möglich, länger in den Klassen eingesetzt als nur ein einzelnes Schuljahr. Jeden Morgen haben wir die „Tagesschau in 100 Sekunden“ geschaut – egal, ob gerade Mathe, Religion oder Kunst angesagt waren – und anschließend darüber geredet. Diese vermeintliche Kleinigkeit hat immer dazu beigetragen, uns auch als Menschen besser kennenzulernen, weil die Betroffenheit von oder die Meinung zu einzelnen Meldungen häufig zum Gesprächsanlass wurde.
Die Kleinräumigkeit beider Schulen (jeweils unter 300 Schüler:innen) trug noch stärker dazu bei, dass man sich einfach kannte. Und dennoch haben wir an beiden Schulen weit häufiger konferiert – informell, aber auch formell. Wenn man Gesamtkonferenzen nur als zähe Veranstaltung kennt, bei der einen die Tagesordnungspunkte immer nur stichprobenartig betreffen, dann klingt das wie die Horrorvorstellung des Jahrtausends. Tatsächlich hat das meinen Berufsalltag aber häufig leichter gemacht: Weil in einer der beiden wöchentlichen Kurzkonferenzen nicht nur nochmal gefragt werden konnte, wenn Abläufe unklar waren, sondern weil jede*r Kolleg*in auch immer die Möglichkeit hatte, mal schnell auf ein gerade laufendes Projekt hinzuweisen, das ihm*ihr und damit auch den beteiligten Schüler*innen wichtig war. Weil man daran eine 2-minütige Zusammenkunft des Klassenteams anschließen konnte und damit individuelle Beobachtungen zur Diskussion stellen konnte, sodass man hinterher wusste, auf was oder wen man im Moment vielleicht besonders achtgeben sollte. Das hat die Beziehungsarbeit wiederum immens erleichtert.
Sich die Mittelschulen zum Vorbild zu nehmen, meint also vor allem, über den Tellerrand zu blicken, um zu sehen, wie Schule auch möglich sein kann. Das trifft in besonderem Maße natürlich auf Schulen wie die Erlanger Eichendorffschule zu, die gerade den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Eigentlich geht es aber schon viel früher los. Nicht bei den Leuchttürmen, obwohl die natürlich erst recht zeigen, dass es auch anders geht. Aber dass es selbst da, wo alles „ganz normal“ läuft, wo es keinen FreiDay! und keine Lernbüros gibt, große Unterschiede geben kann, bestärkt mich immer wieder darin, auch in meinem Alltag nach den Freiheiten zu suchen, die ich mit den Schüler*innen nutzen kann.
Ding 4: Um die Demokratie zu verteidigen, braucht es die Schulen.
Was der Kabarettist Volker Pispers schon vor über zehn Jahren treffend mit „Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt – Deutschland wird in der Hauptschule verteidigt und in der Grundschule, im Kindergarten, in der Gesamtschule und in der Realschule“ auf den Punkt gebracht hat7, kann man natürlich auch wissenschaftlich korrekt ausdrücken:
„Die einschlägige Forschung weist darauf hin, dass erlebter Demokratie – im Unterricht, bei der Gestaltung von Schule als Institution, aber auch in der Gesellschaft insgesamt – eine entscheidende Bedeutung zukommt. Durch positive Erlebnisse und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bilden sich demokratische Einstellungen aus. Umgekehrt bewirken autoritäre Strukturen und autoritäres Verhalten von Lehrkräften oder Vorgesetzten (z.B. im Ausbildungsbetrieb), dass junge Menschen sich zurückziehen, Beteiligung nicht als Gestaltungsmöglichkeit kennenlernen, nicht lernen, Konflikte demokratisch zu lösen und als Ausweg nach imaginären Schuldigen suchen. So steigt die Tendenz steigt sich verfestigender autoritärer Einstellungen.“
Aus dem Policy Paper „Verschwörungsglaube von Jugendlichen: Kann Schule Demokratie stärken?“ von Johannes Kiess, Marius Dilling, Clara Schiessler und Fiona Kalkstein
Warum auch das eine Lehre ist, die ich aus meiner Zeit an anderen Schularten mitgenommen habe, lässt sich einerseits – wie bereits erwähnt – damit erklären, dass ich anderswo andere Ausprägungen von Beziehungsarbeit und auch von Verantwortlichkeit für eine ganzheitliche Bildung mitgenommen habe. Gerade dann, wenn man als Lehrkraft für eine Vielzahl von Unterrichtsfächern zuständig ist #Klassenlehrerprinzip, ist man deutlich weniger zur Verantwortungsdiffusion verleitet, also darauf zu setzen, dass die anderen es schon in ihren Fächern, die gerade viel mehr mit diesem Thema zu tun hätten als das meine, besprechen werden.
Noch viel mehr hat es aber damit zu tun, dass Chancengerechtigkeit nach wie vor eine DER Baustellen im Deutschen Bildungssystem ist. Auf welcher Schule ein Kind im dreigliedrigen Schulsystem landet, hängt nach wie vor in hohem Maß von Faktoren wie sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund ab.8 Gleichzeitig sinkt der Glaube an Verschwörungserzählungen, die demokratische Grundhaltungen bedrohen, mit steigendem formellem Bildungsgrad.9
„Nur“ am Gymnasium gearbeitet und vorher die Universität bzw. ein Gymnasium besucht zu haben, bedeutete damit, mich in einer analogen Filterblase bewegt zu haben, die bestimmend für meine Sichtweise auf die Gesellschaft und unsere Demokratie war. Die Kinder, die in der fünften Jahrgangsstufe eines Gymnasiums ankommen, sind – auch wenn von ihnen als „der jungen Generation“ gemäß der Tradition gerne mal anderes behauptet wird – die Hochleistungsgrundschüler*innen ihres jeweiligen Jahrgangs. Hat man stets nur mit ihnen zu tun, wird einem nicht wirklich bewusst, dass es da auch noch andere gibt.
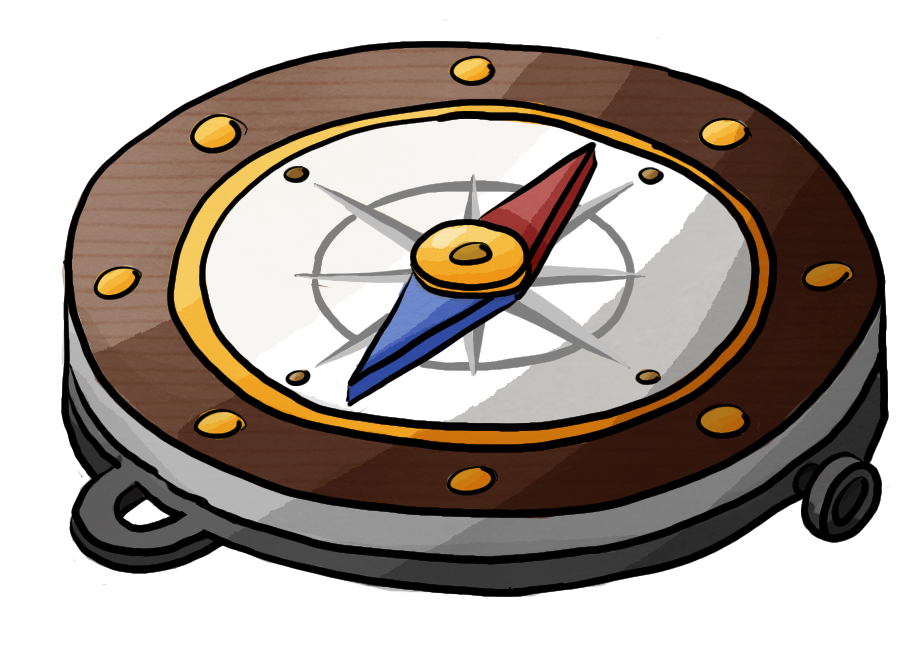
Als ich vor meiner ersten fünften Klasse an der Mittelschule stand, waren die auch gerade ganz frisch angekommen. Allerdings strotzten sie nicht vor Selbstbewusstsein, gerade den Übertritt geschafft zu haben. Bei vielen war das Unternehmen Gymnasium aus notentechnischer Sicht aussichtslos, die Realschule vielleicht auch weit entfernt gewesen. Manche hatten den Probeunterricht dort ebenfalls nicht bestanden und ihnen war gemeinsam, dass sie sich jetzt mit dem abfinden mussten, was eben übrig blieb: Der Mittelschule. Natürlich kamen sie dennoch zu Erfolgen. Viele von ihnen habe ich im Sommer in der Zeitung bewundert, denn sie trugen schicke Klamotten und feierten ihren bestandenen Abschluss.
An dieser Stelle läge es nahe, davon zu schreiben, wie viel ihnen das abverlangt hat. Dass sie es in Summe vielleicht schwerer hatten als die Abiturient*innen, die zeitgleich am Gymnasium, an dem ich letztes Jahr gearbeitet habe, ihre Zeugnisse verliehen bekamen. Das ist Quatsch. Jede*r von uns steckt immer nur in seiner jeweiligen Realität und versucht, das Beste daraus zu machen.
Aber eine Demokratie zu fördern, muss bedeuten, gesamtgesellschaftlich zu denken und dabei nicht so lange über einen Kamm zu scheren, bis der kleinste gemeinsame Nenner übrig bleibt, sondern möglichst viele verschiedene Realitäten mitzudenken, Freiheiten und Sicherheiten für alle zu vergrößern und möglichst viele Menschen zur Mitwirkung zu animieren, sodass sie Selbstwirksamkeit erleben können.
Die Zweifel, ob das gelingen kann, wenn die Filterblasenbildung bereits nach der vierten Klasse beginnt, hat mir die Odyssee gebracht. Die Bedeutung von „an einem Gymnasium unterrichten“ ist eine andere, seit ich die Alternativen aus eigener Erfahrung kenne und nicht mehr nur aus Erzählungen. Gleichzeitig werde ich nicht müde, davon zu erzählen, dass es andere Welten gibt. Denn meine alltäglichen Vorteile aus der äußeren Differenzierung durch das dreigliedrige Schulsystem10 können gar nicht so laut werden, als dass ich die Zweifel nicht mehr hören könnte.
Ding 5: Bildung ist keine Dienstleistung
Wenn ich schon von den analogen schulischen Filterblasen schreibe, dann darf ich eine nicht auslassen: Die Privatschule. Damit meine ich nicht die spezielle, an der ich war, sondern viel mehr die Tatsache, dass es – passend zur oben erwähnten Bildungsungerechtigkeit – unter gewissen Bedingungen, vor allem finanziellen, eben doch möglich ist, den ohnehin schon zahlreichen staatlichen Bubbles ein Schnippchen zu schlagen.
Während ich dem Gedanken an eine stärkere Individualisierung der Bildung sicherlich nicht abgeneigt bin, durfte ich auf meiner Odyssee nicht zuletzt lernen, dass ich die Vorstellung, dass Bildung eine Dienstleistung werden könnte, ziemlich vehement ablehne. „Aha, wusste ich’s doch! Erst solidarisiert sie sich mit den Lehrkräften aller anderen Schularten, dann ist sie sich aber zu fein, um mit Podolog*innen, Reiseverkehrskaufleuten und Reinigungskräften in einen Topf geworfen zu werden!“, denkst du dir jetzt vielleicht. An dieser Stelle geht es mir aber weder um den Tarifvertrag als Grundlage für meine Bezahlung noch darum, dass es nicht durchaus als reizvolle Lerngelegenheit empfände, wenn wir uns an ausgewählten Tagen im Jahr wie Marktschreier*innen in die Aula stellen und unseren Unterricht bewerben müssten, um zu sehen, was bei der Kundschaft wirklich ankommt und was sie halt notgedrungen über sich ergehen lassen.
Dass durch die Schulpflicht das Menschenrecht auf Bildung konsequent umgesetzt werden soll, hat erstmal zur Folge, dass wir uns nicht aussuchen können, was wir in der Schule lernen oder gar wie wir das tun, wodurch das eigentliche Privileg wiederum vielfach nicht als solches wahrgenommen wird. Sicherlich könnten ein Mehr an Auswahl, beispielsweise durch Privatschulen, und der Gedanke für das, was man selbst gewählt hat, zu zahlen, das Belohnungszentrum unseres Gehirns auf ähnliche Weise anregen, wie wir es von anderen Produkten gewohnt sind. Was mit hunderten Shampoosorten, T-Shirt-Aufdrucken und Automodellen funktioniert, wäre doch einen Versuch mit attraktiv verpackten Rechtschreibtrainings oder von Influencer*innen beworbenen Bruchrechnungslerntheken wert, oder?
Ohne zur großen Ökonomin berufen zu sein, kann ich den Unterschied zwischen Bildung als Dienstleistung oder Produkt auf der einen und Bildung als Investment auf der anderen Seite klar ausmachen: Während das Produkt darauf ausgelegt ist, reißenden Absatz zu finden, sodass man am Jahresende Kassensturz machen und wie Dagobert Duck im Geldspeicher baden kann11, erscheint das Investment wie der Baum, den man pflanzt: In seinem Schatten sitzt erst die nächste Generation, man selbst sieht wahrscheinlich eher wenig davon. Aber ganz abgesehen davon, dass auch meine Rente durch den Generationenvertrag bezahlt werden muss, begegnen mir immer wieder Artikel, in denen der Gegenwert von Bildung ganz klar in Zahlen benannt wird. Bildung hat Wertschöpfung zur Folge – individuell und gesellschaftlich.12 Gerade deswegen müsste sie der mega-attraktive Shop mit lauter nachhaltig produzierten Produkten sein, die nicht nur ein gutes Gewissen machen, sondern ihren Wert auch noch stetig steigern, sodass man so viel haben will, dass man freiwillig mit seiner Zeit dafür zahlt. Aber eben bitte nur mit der.13
Dass dieser Gedanke, dass Bildung keine Dienstleistung ist, am Ende der Liste der fünf Dinge, die ich am Gymnasium nie (oder zumindest nicht so schnell) gelernt hätte, steht, ist kein Zufall. Staatliche Planstellen werden häufig vor allem als Garant finanzieller Sicherheit betrachtet und sicherlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ich in dieser Hinsicht nun etwas ruhiger schlafe als zuvor.
Der eigentliche Vorteil liegt aber ganz woanders: Wer nicht an Verkaufszahlen gebunden ist, muss sein Produkt nicht mit übertriebenen Werbeversprechen pushen. Wer seine Arbeit nicht als Dienstleistung an die Kundschaft bringen muss, hat das Privileg, sich an messbaren Erfolgen beziehungsweise Forschungsergebnissen 14 auszurichten statt Optik über Inhalt zu stellen. Und zu guter Letzt: Wer diesen Job gerne gut macht, auch oder gerade im Wissen, dass das System sicher nicht ohne Schwächen ist, darf sich gewiss sein, dass es sich auszahlen wird, die Beziehung über den Lehrplan zu stellen, sich auch an ungewöhnlichen Orten Vorbilder zu suchen, die Demokratie zu verteidigen und zu passender Zeit den Stift fallenzulassen, um für die eigene Lehrerinnengesundheit dasselbe zu tun.
Epilog
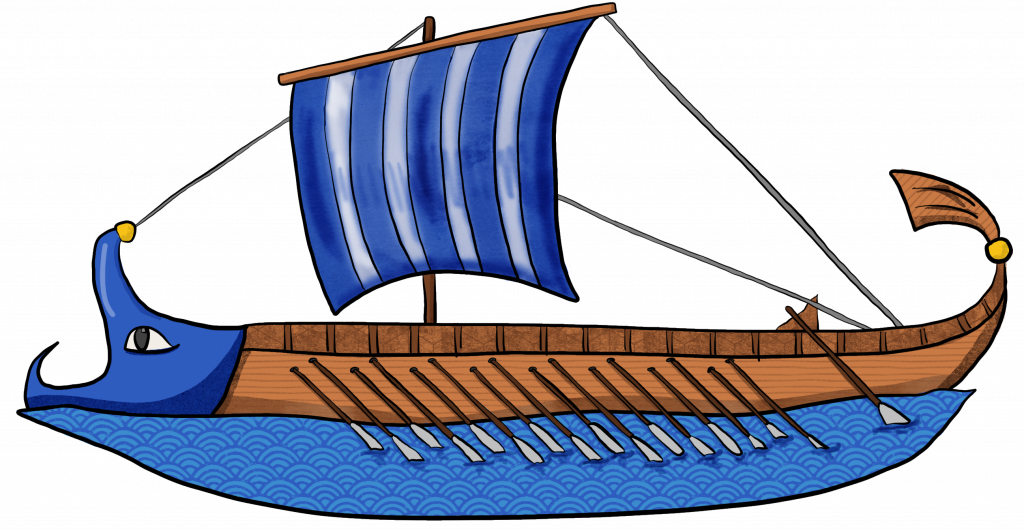
Meine Odyssee mag zu Ende sein. Aber im neuen Heimathafen bin ich in guter Gesellschaft: Um mich herum sind andere, deren Wege ebenfalls nicht immer gerade und klassisch verliefen (Grüße gehen raus an D. und M.). Ich tröste mich damit, dass das nur die Sprints waren und dass der Marathon gerade erst anfängt. Wenngleich ich des Neuanfangens zuletzt müde geworden bin, gilt das nicht für die vielen Ideen, die noch umgesetzt werden wollen. Wovor soll man sich noch fürchten, wenn man so oft in unbekannte Gewässer aufgebrochen ist? Für das nächste Jahr habe ich gleich mal ein P-Seminar-Angebot verfasst: Gamification im Geschichtsunterricht… nicht, dass es noch langweilig wird.
Außerdem lerne ich jetzt Griechisch. Um die Kreter zu verstehen, weil ich auf dieser Insel ein Stück meines Herzens verloren und meinen Fluchtpunkt gefunden habe. Um Kavafis im Original zu lesen, wie so eine abgehobene Gymnasiallehrerin. Um Miltos Pashalidis zu verstehen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber so ist das nunmal mit den Fahrten voller Abenteuer und Erkenntnisse.
Vielleicht lerne ich es ja auch, um irgendwann zum nächsten Ithaka aufzubrechen. Vielleicht kommt mir aber auch vorher ein neues Ziel dazwischen. Wer weiß…
Lizenzhinweis
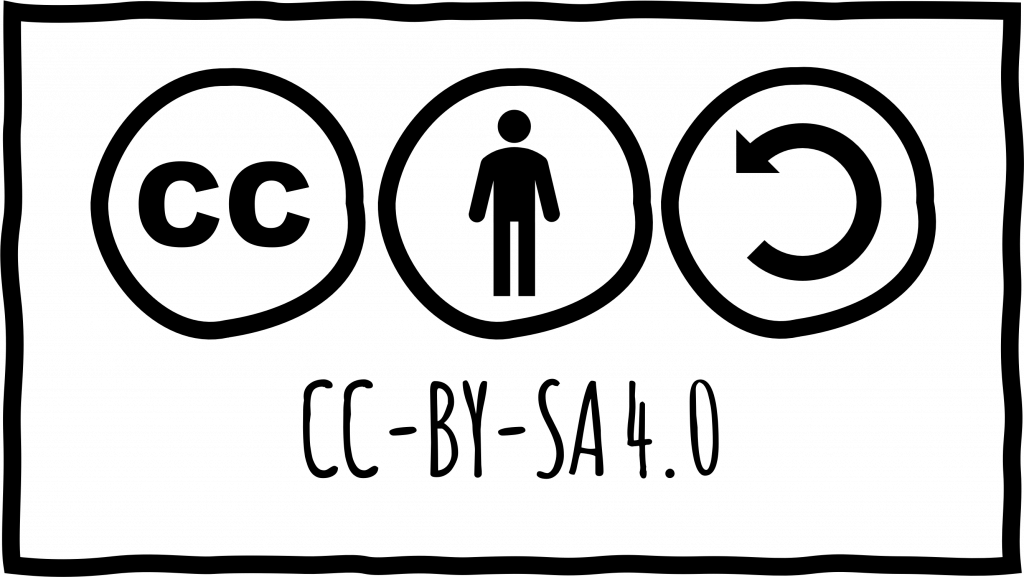
Dieses Werk von Kristina Wahl (diefraumitdemdromedar.de) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
- Natürlich können es auch mehr Jahre werden, denn erstens werden die Planstellen in Bayern zentral vergeben, zweitens gibt es die „Mobile Reserve“ und drittens herrscht auch nicht immer Lehrermangel. Ich spreche ja selbst als lebender Beweis. ↩︎
- Also, als Gymnasiallehrkraft mit klassischem Standardweg: Schule – Uni – Referendariat – Planstelle. Natürlich ist das zugespitzt und wird der Realität, wenn man genau hinschaut, selten gerecht. Das sind die Behauptungen des Philologenverbandes, dass Gymnasiallehrkräfte, weil sie den schwierigsten und arbeitsreichsten Job von allen Lehrkräften machen würden, das meiste Geld verdienen sollten, aber auch. ↩︎
- Dazu die ausführlichen Infos der GEW zum Thema Lehrkräftearbeitszeit und -erfassung. ↩︎
- Sie können sich unter bestimmten Bedingungen „Mittelschule“ nennen und eigentlich heißen mittlerweile auch fast alle so. Warum das so ist, steht im Wikipedia-Artikel. ↩︎
- Bei Interesse kannst du dir die zugehörige Sketchnote hier ansehen/herunterladen. ↩︎
- Ich möchte an dieser Stelle die These aufstellen, dass nicht nur die Schüler*innen an Mittelschulen „ihr Päckchen zu tragen“ haben, dass es aber für sie im Alltag häufig eine größere Rolle spielt, weil die Ressourcen, über die wir alle verfügen, begrenzt sind. Je mehr Ressourcen benötigt werden, beispielsweise, weil man eine Lernschwäche hat, oder belegt sind, weil die Situation zuhause gerade schwierig ist, desto wichtiger wird eben die Beziehungsarbeit, denn nur wenn man davon weiß, kann man individuell reagieren und uns zu öffnen ist eben nichts, was wir Menschen gerne tun, wenn wir einander nicht kennen. ↩︎
- Dass er an dieser Stelle das Gymnasium nicht nennt, hat damit zu tun, dass es in diesem Teil seines Programms um die mangelnde Wertschätzung für Pädagog*innen in der Grundschule bzw. frühkindlichen Bildung ging, nachzusehen in diesem Video. ↩︎
- Wie beispielsweise die Untersuchung von Prof. Dr. Kai Maaz mit Zahlen belegt. ↩︎
- Hierzu finden sich Belege in der Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Glauben an Verschwörungserzählungen, die die Ergebnisse nicht nur nach Parteizugehörigkeit, sondern auch nach Bildungsabschluss aufschlüsselt. ↩︎
- Damit meine ich vor allem den geringeren Grad an Binnendifferenzierung, der am Gymnasium vorgenommen wird, insbesondere im Vergleich mit der Grundschuldidaktik. ↩︎
- Dankt mir später für diesen wunderbaren Ohrwurm. ↩︎
- Dies belegt beispielsweise der lesenswerte Artikel „Was kostet es, nicht in Bildung zu investieren?“ von Katharina Werner für die bpb. ↩︎
- Reicht ja auch, ist ja das Prinzip von Erwerbsarbeit… ↩︎
- Beispielsweise den Ergebnissen der empirischen Bildungsforschung ↩︎
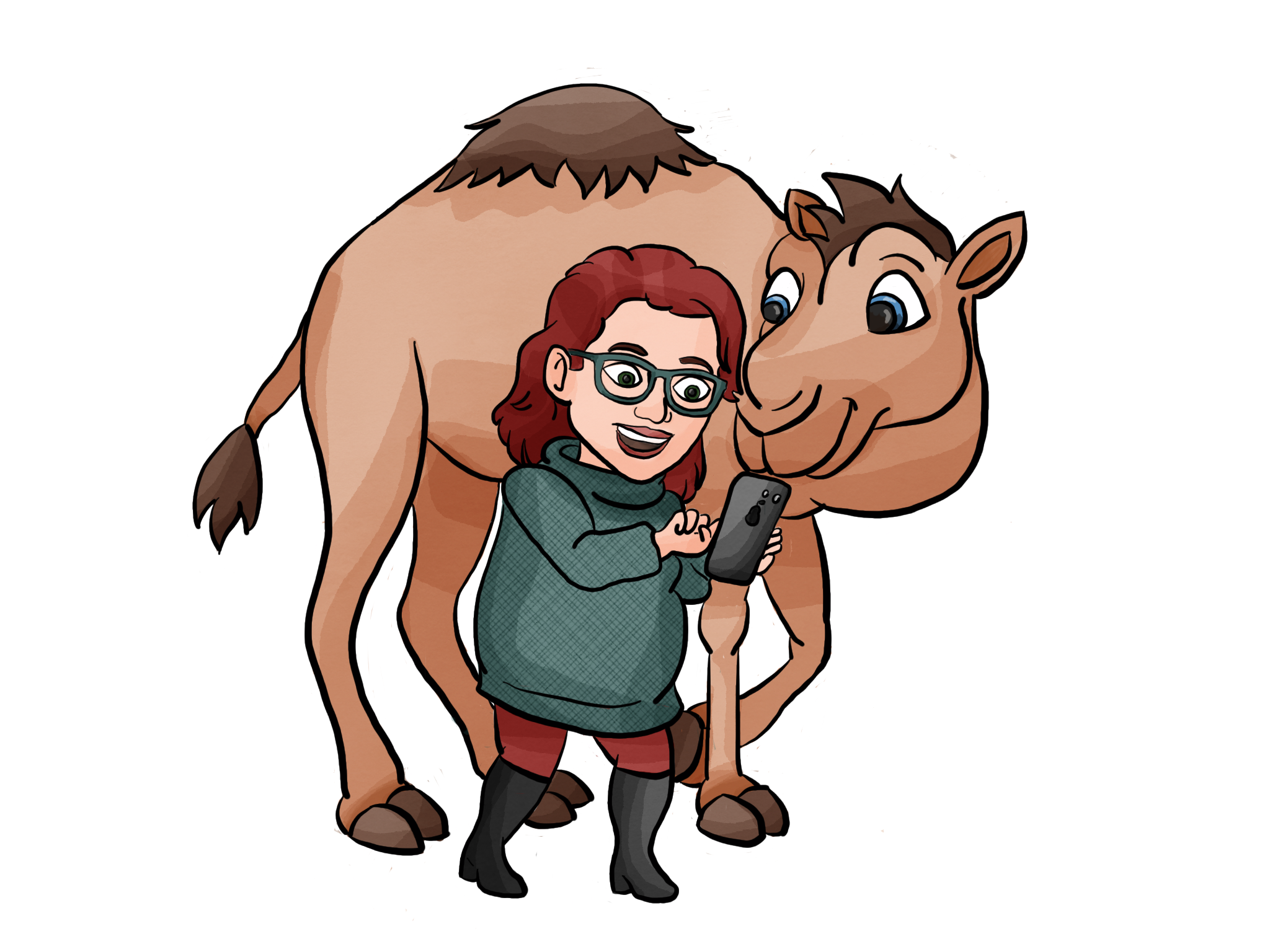
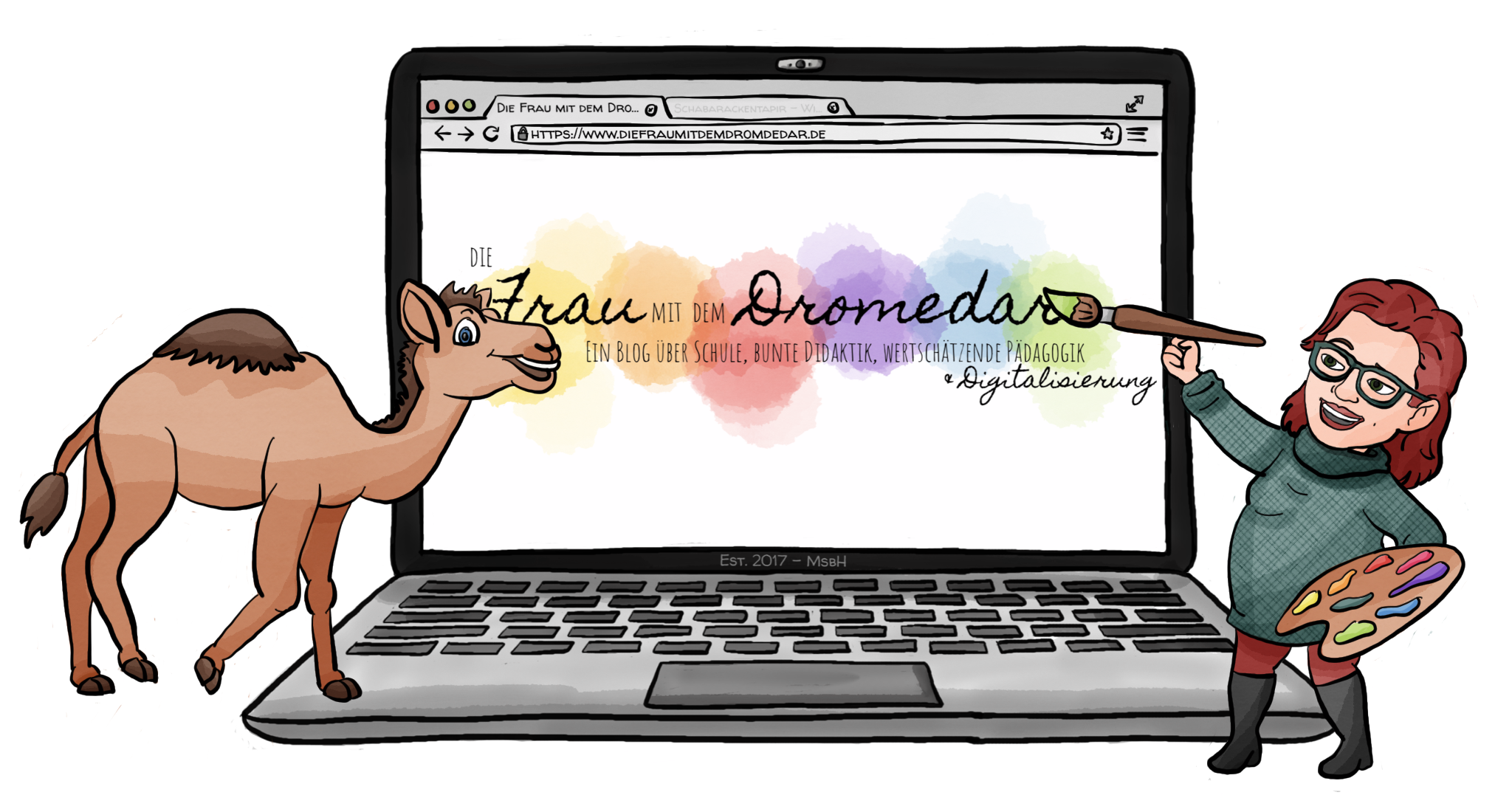
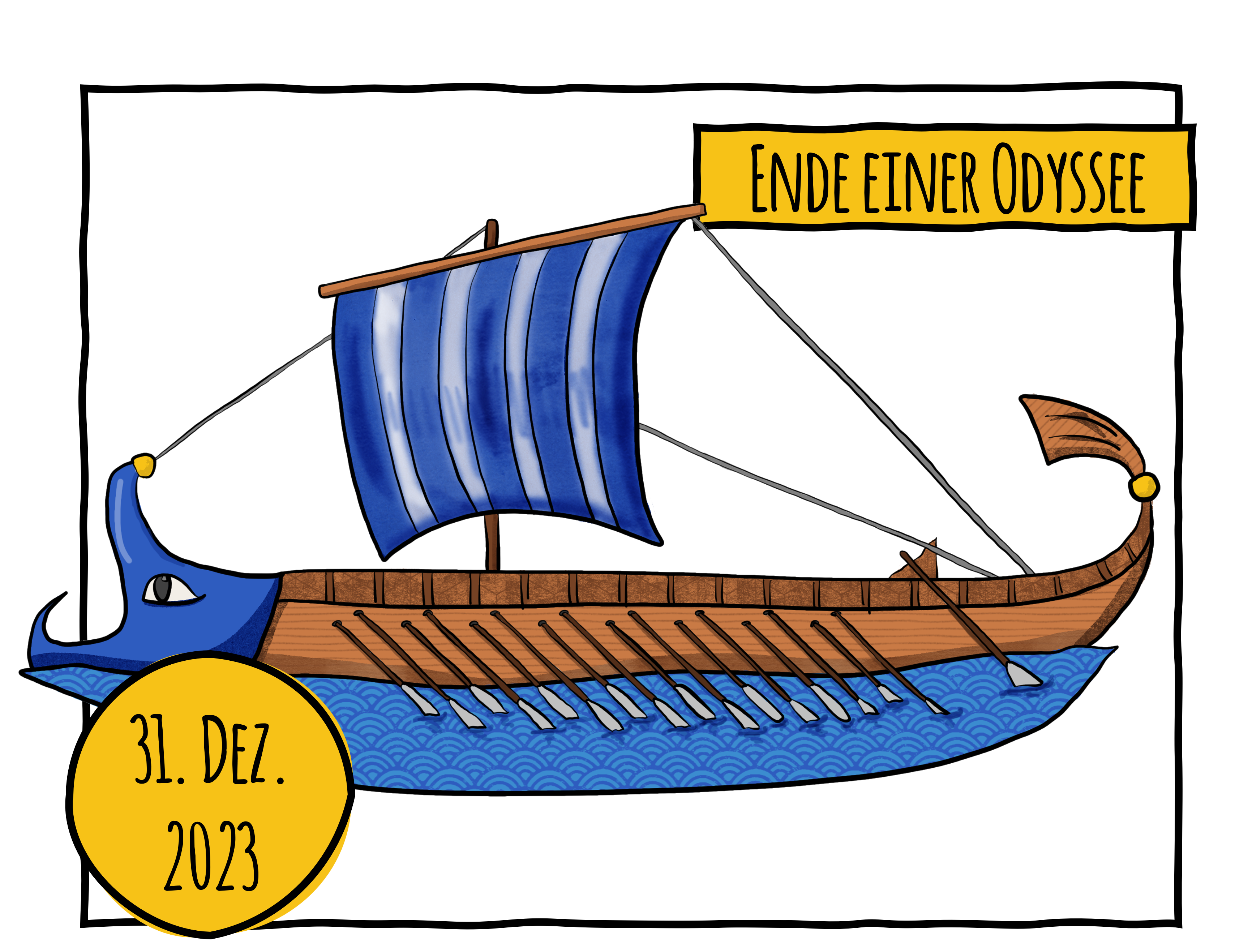
Kommentare
5 Antworten zu „Ende einer Odyssee – oder: 5 Dinge, die du am Gymnasium nicht lernst“
[…] (mein Favorit) und das völlig affige Threads ist bedauerlich. Und während Kollegin Kristina ihren Blog runderneuert hat und begeistert führt, habe ich zuletzt (wieder) darüber nachgedacht, hier den Stecker zu […]
[…] ich im letzten Beitrag vollmundig angekündigt hatte, dass es mit dem Redesign nach dem Ende meiner Odyssee eine neue Funktion bei der Frau mit dem Dromedar geben soll, will ich mit diesem Post und dem […]
[…] Ein Beitrag von der Kollegin mit dem Dromedar, Kristina Wahl, zu Dingen, die man am Gymnasium nicht lernt: https://diefraumitdemdromedar.de/ende-einer-odyssee-oder-5-dinge-die-du-am-gymnasium-nicht-lernst/. […]
[…] zu ihrer Odyssee durch verschiedene Schulformen und den Dingen, die man am Gymnasium nicht lernt: https://diefraumitdemdromedar.de/ende-einer-odyssee-oder-5-dinge-die-du-am-gymnasium-nicht-lernst/.Ein Beitrag zur Diskussion um die Aussagekraft zur Noten auf SPON (weil wir auf dem Pädagogischen […]
[…] mit neuer Vorbereitung konfrontiert sind. (Falls dir der Kontext fehlt, hier der Link zu meiner Odyssee der 6 Schulen und 4 unterschiedlichen Schularten). Gerade die Erfahrung des ständigen Neu-Anfangens und der immer wieder veränderten Anforderungen […]