Prolog
Wir sind die Guten. Wir sind Teil einer Graswurzelbewegung, wir sind die digitale Avantgarde – die, die die ausgetretenen Pfade verlassen und voranschreiten auf neuen Wegen – WIR werden die sein, von denen man in den Geschichtsbüchern lesen wird, dass sie die Digitalisierung der Schulen maßgeblich vorangebracht haben, weil sie unermüdlich in den Sozialen Medien und auf ihren Blogs dafür gestritten haben, dass die Technik in die Schulen muss, aber halt – da ist noch viel mehr – dass sie mit einem Masterplan, gerne „Konzept“ genannt, in die Schule muss, damit diese zukunftsfest wird! Wir glauben daran, dass wir die Enzyklopädisten unter den Revolutionären sein werden – die, die bereits alles Wissen zusammengetragen hatten, bevor Fackeln und Mistgabeln zum Sieg über überkommene Systeme verhelfen werden! Fehlendes WLAN wird uns nicht aufhalten, Kreidestaub unser Drängen nicht bremsen, BYOD* hat schließlich bei den Mistgabeln auch schon funktioniert! Und jetzt alle: „Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons!“ Vive la revolution! ☠️
*BYOD („Bring your own device“) = das Mitbringen der digitalen Endgeräte wie Smartphones durch die SuS

Realität und Realitätsflucht
Ich glaube fest daran, dass ein „Ort“ wie das #twitterlehrerzimmer etwas ist, das viele von uns ganz dringend brauchen, um ihren Job genauso zu machen, wie sie ihn tagtäglich machen: Ein Platz, an dem man Gleichgesinnte trifft, die nicht in einem ominösen alten Trott verhaftet, das System nie hinterfragend ihren Job machen, sondern immer mit einem Blick nach vorn, auf das schon jetzt Machbare und auf die Innovation in die Schule gehen. Es ist eine Realität – wenn auch eine digitale – und gleichzeitig eine Realitätsflucht, weil es immer auch zum Träumen einlädt, denn wenn wir sehen, was dort vereinzelt möglich ist, wo die Revolution schon weiter vorangeschritten zu sein scheint als in unserem eigenen Mikrokosmos, dann ist das gleichsam eine Einladung die Ideen weiterzuspinnen und sich in den Gedanken an eine ferne Zukunft zu verlieren. Um es mit Oscar Wilde zu sagen:
“A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realisation of Utopias.”
[„Eine Weltkarte, auf der Utopia nicht verzeichnet ist, ist es nicht wert, dass man einen Blick auf sie wirft, weil sie dieses eine Land ausspart, wo die Menschheit immer anlandet. Und wenn die Menschheit dort ankommt, sieht sie sich um und setzt – ein besseres Land vor Augen – die Segel. Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.“]
Oscar Wilde: The soul of man under Socialism (1891)
Jeder, der innovativ sein will, der braucht diese Weltkarte, auf der die Utopie verzeichnet ist, das Noch-Nicht-Machbare und die Richtung, in der man dies suchen und erreichen kann. Progress – Entwicklung oder Fortschritt, je nachdem, wie man es übersetzen möchte – bedeutet, Utopien zu realisieren und ein Blick auf die Welt zeigt, dass sie genau das nach wie vor bitter nötig hat, weswegen wir ganz dringend in den Schulen damit anfangen sollten, wo der Blick der jungen Menschen auf die Landkarten geprägt wird.
Gleichzeitig bringen wir uns in eine Bredouille, wenn wir im Digitalen den Träumen nachhängen, die im Analogen so weit weg erscheinen: Was am Abend noch in einer lebhaften Twitter-Diskussion ausgefochten wird, bedürfte am nächsten Morgen in der Kaffeeküche noch einer stundenlangen Vorrede, um alle Anwesenden auf den Stand zu bringen, den sie bräuchten, um wirklich folgen zu können. Oft haben wir keine Zeit, um den nötigen Prolog zu halten und den aktuellen Sachverhalt zu diskutieren, obwohl es gewinnbringend für alle Beteiligten sein könnte. Manchmal befürchten wir auch einfach, Kopfschüttelnfür unsere Träumereien zu ernten von denen, deren Landkarte Utopia (noch) nicht zu verzeichnen scheint oder wir müssen uns – so traurig dies im Jahr 2017 auch erscheinen mag – einem festgefügten Usus beugen, obwohl er aus objektiven Gründen angezweifelt werden darf.
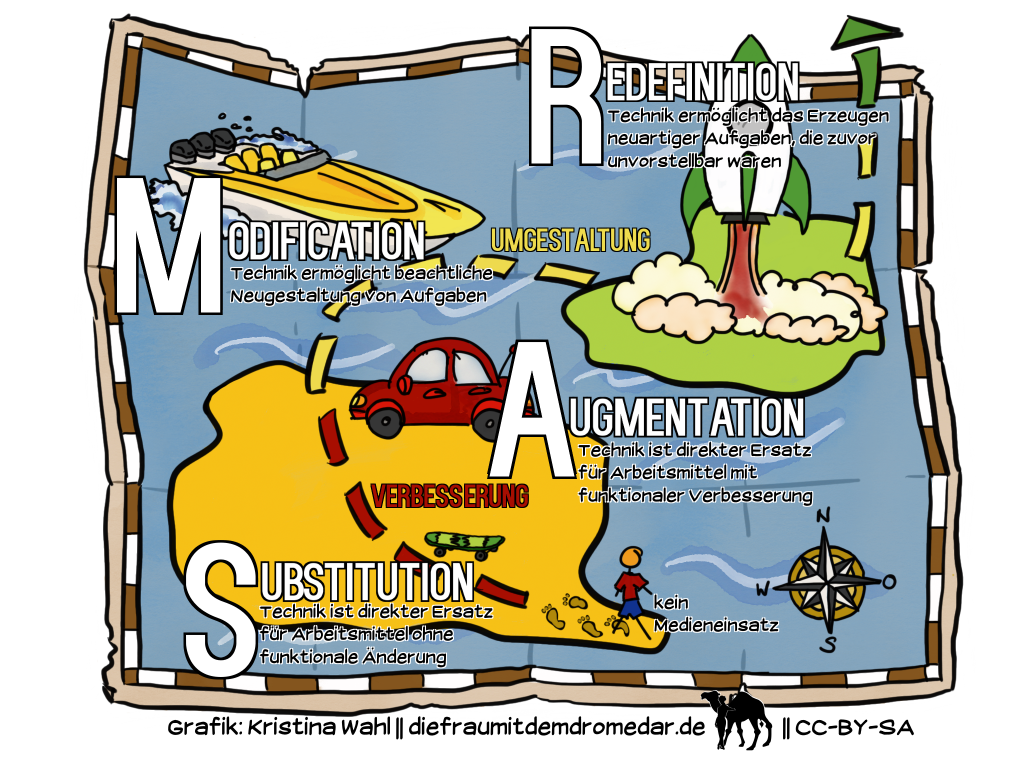
Dieses Essay ist das Ergebnis eines lange in mir schwelenden Konflikts: Einerseits ist mir die Position „Einfach mal machen!“ die liebste: Ausprobieren, einbringen, weitererzählen, Schritt für Schritt und dabei die Zeit lieber fürs Informieren als fürs (Zer-)Diskutieren von Konzepten aufzuwenden, solange ich glaube, die nötige Expertise noch nicht zu besitzen, weil die Praxis des Lehrerberufs nun einmal nicht nur die Theorie, sondern auch die Empirie (im Sinne des Erprobens und Evaluierens) umfassen sollte, um tragfähige Aussagen zu treffen. Gleichzeitig juckt es mich doch immer wieder in den Fingern, dazu etwas beizutragen und der Rahmen von 140 Zeichen ist dabei schon lange überschritten.
Niemals werden meine Gedankengänge an die des großen Roger Willemsen heranreichen, aber der Idee seiner großartigen Rede „Wer wir waren“ möchte ich mich bedienen, wenn ich im Folgenden #my2cents zur Digitalisierungsdebatte beisteuere: Wenn ich nun einen Blick auf das gegenwärtig Diskutierte werfe, dann möchte ich das einerseits aus meiner Perspektive als zumindest randständig Involvierte und ihr Bestes Gebende tun. Andererseits werde ich mir aber auch vorstellen, wie es mir erginge, wenn ich diejenige wäre, die die Debatte und Ereignisse in ein zukünftiges Geschichtsbuch einschreiben wird – freilich ohne wissen zu können, ob diese Revolution eine Geschichte der Sieger oder der Verlierer sein wird.
Reform oder Revolution? – Von Enzyklopädisten und Mistgabelschwingern
Wenn ich die im Digitalen Engagierten eingangs als die Vorreiter der Revolution beschrieb und damit alle, die noch nicht allzu viel mit der Digitalisierung anfangen können, mit den „Mistgabelschwingern“ vergangener Revolutionen wie der Französischen (1789) verglich, dann ging es mir ausdrücklich nicht darum, sie zu diskreditieren, sondern durch Polemisierungden Blick für einen Perspektivenwechsel der „Digitalisierten“ zu öffnen, der mir sehr am Herzen liegt:
Der Unterschied zwischen Reform und Revolution besteht darin, dass Reformen „von oben“, also durch die Leitung des bestehenden Systems angeregt beziehungsweise verordnet werden, während die Revolution bestehende Verhältnisse durch die Auflehnung der vom System Betroffenen „von unten“ gewaltsam oder friedlich verändern will. Für den Begriff der „Digitalisierung“ folgt also, dass er zunächst eher neutral einen Veränderungsprozess beschreibt, von der „Digitalen Revolution“ hingegen können wir eigentlich nur dann sprechen, wenn wir davon ausgehen, dass die Veränderungen im System nicht durch neue Vorgaben angestoßen werden, sondern dass im Fall der Schule LehrerInnen (und SchülerInnen! Die werden gerne mal vergessen… ) als wichtigste Auslöser der Neuerungen fungieren, die anschließend von Seiten des Systems übernommen bzw. in Reformen der Richtlinien integriert werden.
Eines der maßgeblichen Probleme, das sich uns bei der Digitalisierung stellt, ist, dass wir oft gar nicht so genau wissen, ob wir jetzt Reform oder Revolution anstreben. Da wir auf möglichst schnelle Veränderungen hoffen, wollen wir wahrscheinlich beides – und deswegen richten wir unser Bestreben einerseits darauf, Konzepte zu entwickeln, zu diskutieren (und gelegentlich in einer heftigen Debatte zu zerlegen ^^), andererseits versuchen wir, Erfahrungen zu sammeln und diese in (Blog-)Artikeln, (Mikro-) Fortbildungen sowie im täglichen Gespräch weiterzugeben, um weitere begeisterte Anhänger zu gewinnen, den Prozess so zu beschleunigen, um vielleicht irgendwann doch noch das Gefühl zu bekommen, dass es sich bei dieser ganzen Geschichte wirklich um eine Revolution handelt und nicht nur um einen Enzyklopädisten-Kaffeeklatsch, bei dem die hochtrabenden Pläne dafür geschmiedet werden.
Die Diskussion um den Mehrwert – Ein Beispiel aus dem analogen Lehrerzimmer
Enzyklopädisten-Kaffeeklatsch? Zugegeben, ich bewege mich gerade auf ganz dünnem Eis, eine Community so zu bezeichnen, deren Teil ich mit diesem Blog gerne sein würde… „Sowas macht man nicht!“, dürft ihr mir gerne sagen, ich empfinde es ja selbst nicht gerade als die feine englische Art. Aber wenn ich mir ansehe, welche Quintessenzen aus diesen Diskussionen in analogen Lehrerzimmern ankommen, dann vergeht mir mein Optimismus gelegentlich, dann werde ich zynisch und manchmal auch ein bisschen wütend. Warum?
Beispiel: Letzten Freitag lief ich mit dem Kollegen C. zum Parkplatz, der zuvor zufällig mitbekommen hatte, dass Digitalisierung zu meinen Steckenpferden zählt, weswegen sich ein angeregtes Gespräch entspann, denn er war kurz zuvor auf einer Fortbildung gewesen und hatte sich darüber hinaus so seine Gedanken zum Thema gemacht, weil es ihn interessierte. Einerseits sah er die Nutzung der Technik positiv (auch weil er gerade einen Film mit einer Klasse gedreht hatte und ihren Nutzen live erlebt hatte), andererseits zeigte er sich bereit, die Nutzung kritisch zu hinterfragen (zum Beispiel in Sachen Datenschutz). Wir führten ein angeregtes Gespräch, ich freute mich, mal aus dem Nähkästchen plaudern zu können, er freute sich, über die Erfahrungen diskutieren zu können. Alles schick. Bis folgender Satz fiel: „Und dann haben sie [die Fortbildenden] uns gesagt, dass wir nicht nach dem Mehrwert der digitalen Medien fragen sollen! Kannst Du mir das erklären?!“
Ich bin echt nicht auf den Mund gefallen und für gewöhnlich auch recht ausgeglichen – sonst wäre ich im falschen Beruf – aber in diesem Moment musste sich mein pädagogisch-didaktisches HB-Männchen erst kurz von der Implosion erholen, bevor ich zu einer Erklärung ansetzen konnte: Hatte ich richtig gehört? Das gab man den Teilnehmern einer Fortbildung mit auf den Weg, bei der es sonst beispielsweise um die Einführung in die Nutzung der Dokumentenkamera ging – offenbar ohne ihnen wirklich die Chance zu geben, diese Idee zu durchdringen? Ich kam mir ein bisschen vor, als müsse ich einem Achtklässler die aristotelische Dramentheorie erläutern, weil ihm ein Kollege im Unterricht gesagt hatte, dass er den „Besuch der alten Dame“ nicht würde lesen können, ohne davon gehört zu haben…
Keine Sorge, ich konnte das Unverständnis der Mehrwert-These aufklären, denn glücklicherweise habe ich Axel Krommers (@mediendidaktik_) Kommentar dazu gelesen und dadurch verstanden, worum es geht, weil er es mit dem folgenden Alltagsbeispiel anschaulich auf den Punkt bringt:
Trotzdem – oder gerade deswegen – hing für mich nach diesem Gespräch mit C. einmal mehr die Frage im Raum, die sich mir schon so oft stellte, wenn mir KollegInnen von Fortbildungen zu digitalen Medien berichteten, denen sie trotz großen Interesses nicht folgen konnten, weil ihnen dafür Vorkenntnisse fehlten oder weil sie einfach viel zu schnell in Themengebiete eingeführt wurden: Können unsere Forderungen nach der „Digitalen Revolution“ wirklich auf fruchtbaren Boden fallen, wenn wir einen der obersten Grundsätze der Fachdidaktik, die Lernerorientierung, die wir tagein, tagaus auf unsere SuS anwenden, bei den KuK nicht ausreichend berücksichtigen und sie stattdessen mit Thesen überfahren, für deren Entwicklung oder Durchdringung wir selbst bei Weitem mehr Zeit gebraucht haben, als wir ihnen während einer Fortbildung zugestehen?Kann Begeisterung wirklich anstecken, wenn wir zwar überzeugt davon sind, dass die Digitalisierung gut ist, wir aber den KuK nicht gestatten, nach dem Mehrwert zu fragen, obwohl es doch – zumindest für den Anfang – vollkommen legitim sein sollte, zu fragen: „Was habe ich davon? Wie verbessert es meinen Unterricht?“
In der Digitalisierungsdebatte verlangen wir, dass umfassende Konzepte entwickelt und umgesetzt werden müssen, dass ausgetretene Pfade verlassen werden, um neue zu betreten, ja, um Schule und Unterricht vollkommen neu zu denken. Während wir ganz genau wissen (sollten), dass SuS Zeit brauchen, um ein literarisches Werk wie den „Faust“ zu verstehen – und eigentlich auch wissen, dass man ihn mit jedem neuen Lesen ganz anders wahrnimmt und neue Facetten entdeckt – setzen wir bei unseren KuK voraus, dass sie innerhalb eines (Nachmit-)Tages auf den Stand kommen, den wir uns in mühsamer Arbeit, mit viel Interesse und regen Diskussionen täglich neu erschließen?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mitnichten das Gefühl, die geballte Macht der Digitalisierung zu erfassen, weil der Fortschritt tagtäglich neue Apps und Ideen, Konzepte und Debatten in die Weiten des Internets wirft, dass es mir rein kapazitätstechnisch betrachtet überhaupt nicht möglich ist, so informiert zu sein, wie ich es gerne wäre, geschweige denn diese ganzen neuen Ideen adhoc in meinen Unterrichtskonzepten umzusetzen: Selbst wenn ich mir nur die herauspicke, die ich unbedingt ausprobieren will und die ich spannend finde, stehen dem immer die begrenzte Anzahl an Klassen und Fachlehrplänen UND die damit automatisch einhergehende Arbeitsbelastung im Weg.
Daraus will ich nicht folgern, dass es ein sinnloses oder mit zu großen Mühen belastetes Unterfangen wäre, sich der „Digitalen Revolution“ zu verschreiben, im Gegenteil. Aber je mehr ich darüber nachdenke, drängt sich mir die Vermutung auf, dass wir jede/n einzelne/n KollegIn brauchen, wenn es darum geht, die Digitalisierung voranzubringen und dass wir ihnen und uns gleichzeitig die Frage nach dem Mehrwert zumindest insofern zugestehen müssen, als dass es legitim sein muss, zu fragen, was sich konkret für den eigenen Unterricht, die Arbeitsbelastung und vor allem den Lernerfolg der SuS bessert, wenn man die Zeit und die Mühe investiert, die notwendig ist, um sich auszukennen, obwohl „guter Unterricht“ im Sinne der Anforderungen, die durch die Vorgaben an uns gestellt werden, nach wie vor auch mit überwiegend analogen Mitteln möglich ist und das Unterfangen Digitalisierung ohne die entsprechenden Geräte, WLAN und Fortbildungen viel Engagement und Enthusiasmus erfordert.
Destruktive Kritik?
Möglicherweise wird man mir jetzt vorwerfen, es sei destruktive Kritik, die Frag-nicht-nach-dem-Mehrwert-These zu den Akten legen zu wollen. Aber darum geht es mir nicht. Ich würde gerne das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Frage nach dem Mehrwert eine wichtige Orientierungsfrage sein kann, weil wir eine Entwicklung diskutieren, deren Folgen wir nicht absehen können und deren Ziel wir nicht definieren können, weil alles im Fluss ist und bleibt, solange es Schule gibt, die sich entwickelt.
Sie ist auch und gerade deshalb legitim, weil es eine Idee von „gutem Unterricht“ gibt, der wir uns bereits jetzt verpflichten (und das tun im Übrigen auch sehr viele KollegInnen, die von Digitalisierung wenig Ahnung haben – nur, um das mal erwähnt zu haben): Didaktische Prinzipien, die wir erfüllen wollen – für den Augenblick haben wir also sehr wohl ein Ziel vor Augen, auch wenn wir bestrebt sind, dieses im Laufe der Zeit höher zu hängen und in neuen utopischen Gefilden anzulanden. Ob Hilbert Meyers Prinzipien guten Unterrichts, die Hattie-Studie, Christoph Eichhorns Konzept vom Classroom-Management oder einschlägige fachdidaktische Werke – sie alle formulieren pädagogische und didaktische Ansprüche an guten Unterricht und gute Pädagogik, denen wir gerecht werden sollen und wollen, wenn wir unterrichten, weil sie der Stand der Wissenschaft sind (und uns durchaus einsichtig ). Digitalisierung kann in gewissem Maße dazu beitragen, diese Ansprüche zu erfüllen – sie gibt also Antworten auf die Frage nach dem Mehrwert, weswegen ich es für fahrlässig halte, die Frage im Vorhinein zu verbieten und dadurch auf einen Idealismus zu setzen, der denen zu eigen sein mag, die neue Wege beschreiten, obwohl ihnen diese niemand vorgeschrieben hat und die sich – vergessen wir das nicht – in der Materie bereits so weit auskennen, dass sie es akzeptieren können, sich um die Digitalisierung zu bemühen, auch ohne direkte Mehrwert-Orientierung.
Träumereien aus dem Elfenbeinturm
Schon während meines Studiums, aber auch im Berufsleben habe ich es immer wieder erlebt, dass pädagogische und didaktische Konzepte deswegen abqualifiziert wurden, weil ihnen fehlende Praxisnähe vorgeworfen wurde. Wenn ich mir ansehe, welchen „Optimismus“ (bezogen auf die Leistungsfähigkeit der Klassen und das Fassungsvermögen einer Unterrichtsstunde) meine Stundenverläufe, die ich während des Studiums für Didaktik-Seminare verfasst habe, ausstrahlen, dann kann ich gar nicht anders, als dem zu einem kleinen Teil beizupflichten, denn das, was als Anspruch formuliert wird, erweckt unter den Realbedingungen von Schule häufig den Eindruck einer Träumerei aus dem Elfenbeinturm.
Gleichzeitig habe ich gelernt, dass diese „Träumereien“ didaktischer und pädagogischer Zielformulierungen verteidigt werden müssen, weil sie die Utopien sind, die wir auf der Landkarte sehen sollten, wenn wir Schule entwickeln wollen. Mit der Digitalisierung und den Kommunikationsmöglichkeiten im digitalen Raum wird es möglich, die Neuigkeiten aus dem Elfenbeinturm nicht nur schneller auf dem Schirm zu haben, sondern auch an ihnen mitzuwirken. Ich halte das für ein großes Geschenk, das wir nicht verspielen sollten, indem wir einen eigenen Praxis-Elfenbeinturm daneben bauen und alle Interessierten einladen, doch mal auf einen Kaffee vorbeizuschauen, um die Aussicht zu genießen.
Das Gleiche gilt im Übrigen auch für unseren Umgang mit SuS: Wie Christian Spannagel (@dunkelmunkel) in diesem Videotreffend erklärt, ist der Begriff „Digital Native“ wenig tragfähig, sobald es darum geht, mit digitalen Endgeräten etwas zu tun, was über Spiele, WhatsApp und Snapchat hinausgeht. Realistisch und im größeren Zusammenhang betrachtet ist dies auch gar nicht weiter verwunderlich: Ich konnte früher auch hervorragend mit Büchern umgehen – solange ich sie zu meinem Vergnügen gelesen habe. Wie man ein Wörterbuch richtig benutzt oder einen Fachtext verstehend liest und zusammenfasst, habe ich erst in der Schule gelernt. Auch in diesem Zusammenhang wäre es also nur konsequent, den Lernstand realistisch zu analysieren und aufbauend auf dem, was sie lernen sollen, Konzepte zu entwickeln, statt sich darüber zu wundern, dass die SuS weder Lernapps kennen, noch wissen, wie sie ihre Mails abrufen oder eine Dropbox bedienen.
Anders ausgedrückt: Wenn wir unseren Fokus in Blogartikeln, in der Kaffeküchen-Kommunikation und in Fortbildungen immer wieder darauf legen, wie „der Lehrer“ mit Dokumentenkameras, Smartboards und Apps Grandioses seinen Unterricht verbessern kann, dann tappen wir in die Falle der Lehrerzentrierung, die wir eigentlich gerade energisch von uns weisen, wenn wir von der Demokratisierung und Öffnung des Unterrichts im Zuge der Digitalisierung sprechen.
Ich nehme mich von dieser Kritik nicht aus, denn auch ich schreibe mir hier die Finger wund, um zu zeigen, was LuL ändern könnten, und vernachlässigte bisher – wohl aus Bequemlichkeit, vielleicht auch weil das Thema, wie erwähnt, so oder so schon komplex ist – das Weiterspinnen dieser Perspektiven bezogen auf diejenigen, um die es in der Schule eigentlich geht.
Deswegen heißt dieser Artikel „Es geht nicht um uns“, denn in der Digitalisierungsdebatte zeigt sich – wie im schulischen Alltag – immer wieder, dass die Umsetzung von Stoffen und Ideen in Unterrichtskonzepte uns so viel abverlangt, dass wir den Lernerfolg der SuS manchmal erst dann wieder in den Blick nehmen, wenn wir mit einer geplanten Stunde vor ihnen stehen oder gar wenn wir sie einen Test schreiben lassen, der nicht nur ihr Lernen, sondern auch unser Lehren auf Erfolg prüfen soll.
Wer werden wir gewesen sein?
Wenn ich mir etwas wünschen kann, das in einem Geschichtsbuch über uns zu lesen sein wird, eine Antwort auf die Frage, wer die waren, die sich über Digitalisierung die Köpfe heißgeredet, die Revolution im Kleinen umgesetzt und die Reform im Großen gefordert haben (denn sind wir ehrlich: eine echte Revolution liegt außerhalb des Amtseides… ), dann möchte ich lesen, dass wir all das getan haben, um Schule zu einem besseren Lernort für die SuS zu machen, dass wir es geschafft haben, sie mit den neuen Medien für zeitgemäße und unzeitgemäße Bildung zu begeistern, dass wir durch all die Diskussionen und die Adaption ihrer Lebensrealität dazu beigetragen haben, dass sie sich von Schule mehr „abgeholt“ fühlen durften als die Generationen vor ihnen, sodass sie manchmal vielleicht sogar den Eindruck bekamen, dass sie wirklich nicht für die Schule lernen, sondern fürs Leben. Ich möchte, dass wir innovationsbereit und nicht -resistent genannt werden, konstruktiv statt destruktiv, pädagogisch wertvoll statt schülerfern – und vor allem würde es mich freuen, wenn man all diese Entwicklungen hinterher als eine Bewegung begreifen könnte, die von unten getragen und von oben befördert wurde, die Reform und Revolution miteinander vereinte und die alle Beteiligten, die das System Schule umfasst, näher zusammengebracht hat.
Die Digitalisierung des Lehrens und Lernens umfasst so viel, dass es nicht auf einen Satz gebracht werden kann, um eine Definition zu produzieren, die ihr gerecht wird. Und deswegen halte ich sie für einen großartigen Ausgangspunkt, um konstruktiv über Schule zu sprechen und sie voranzubringen – solange wir dabei nicht vergessen, dass die positiven Facetten der Institution gerade durch analoge Merkmale geprägt werden: Lernen innerhalb einer sozialen Gruppe als Live-Erfahrung ist ein Erlebnis, das kein Endgerät je ersetzen können wird, weil Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse umso wertvoller werden, wenn jemand da ist, mit dem man sie teilen kann.
Wenn wir uns dessen bewusst bleiben, können wir getrost Kurs auf Utopia nehmen.
Lizenzhinweis
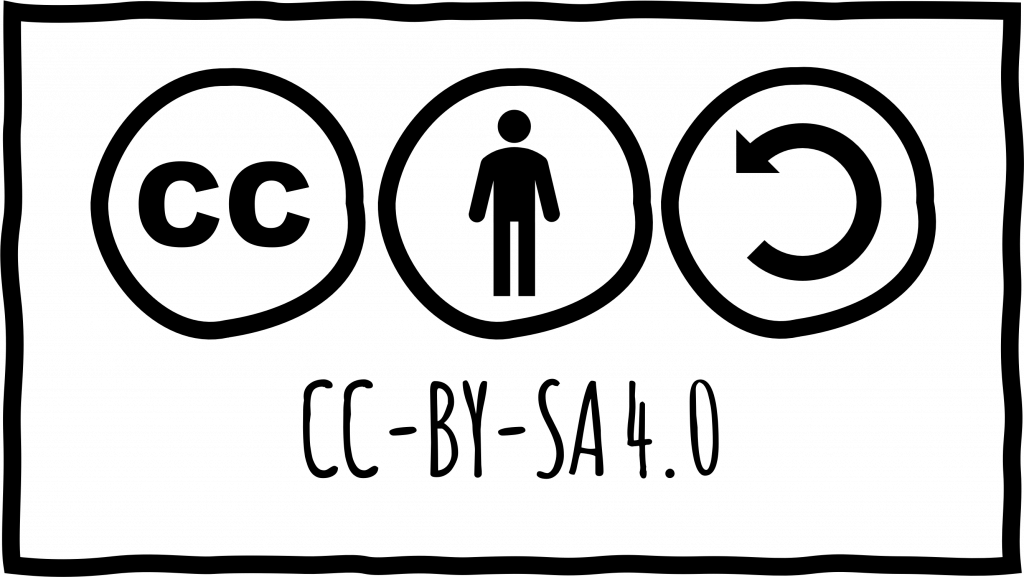
Dieses Werk von Kristina Wahl (diefraumitdemdromedar.de) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
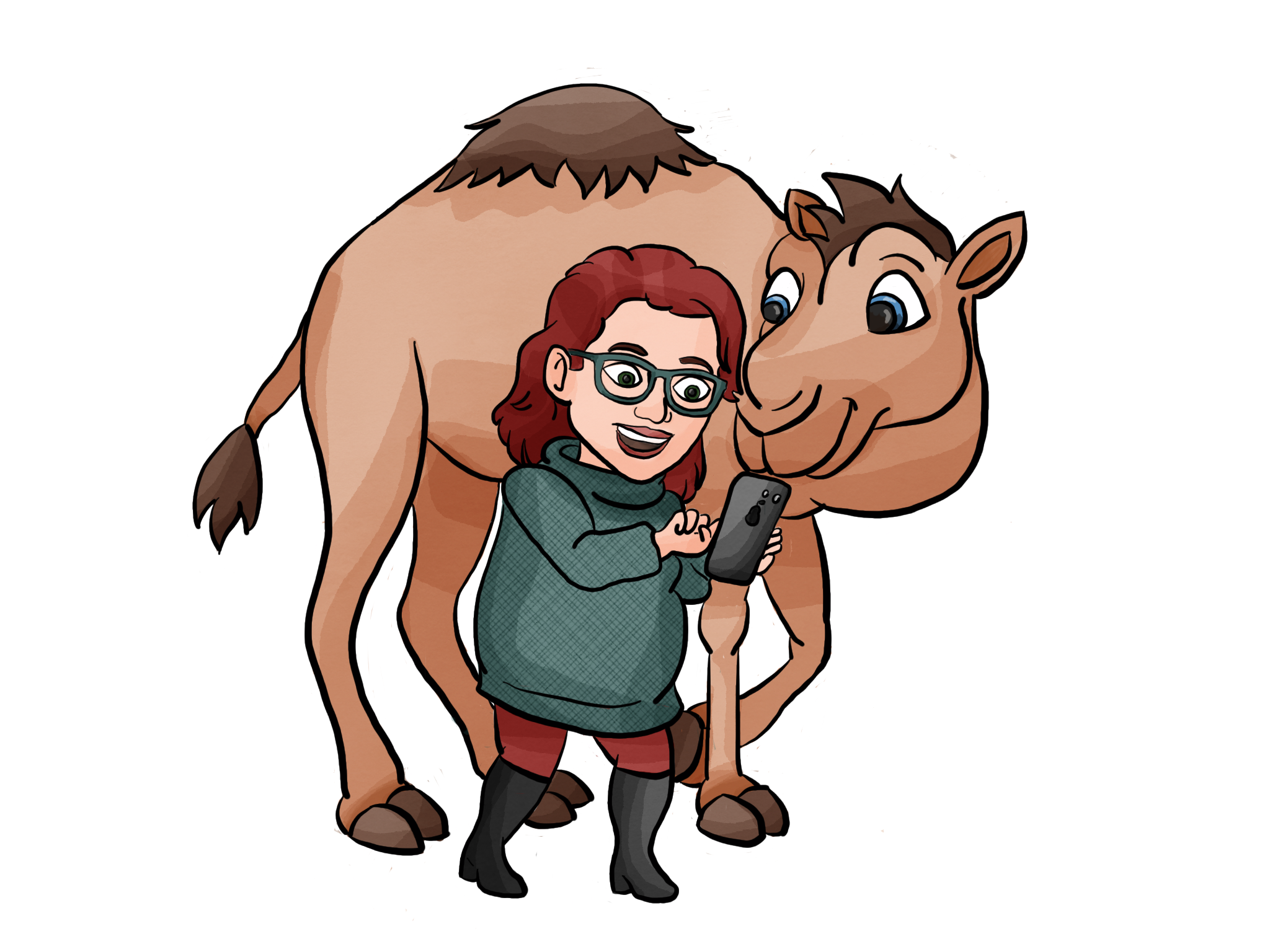
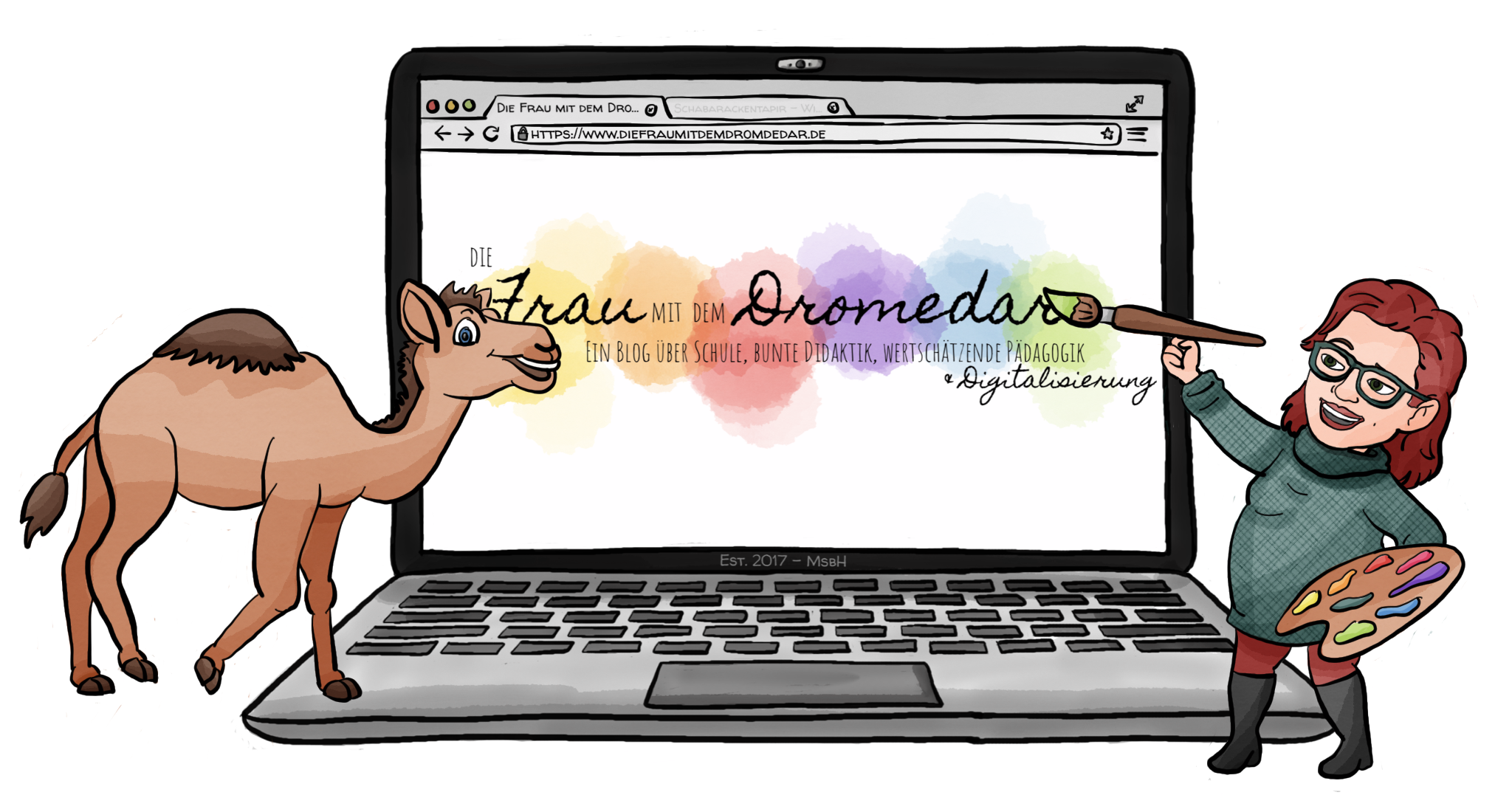

Kommentare
2 Antworten zu „Es geht nicht um uns.“
[…] statt an die eigene Entwicklung zum Status Quo zurückzudenken und dem Gegenüber zuzugestehen, dass auch seine Entwicklung kontinuierlich erfolgen wird. (Auch dieser Gedanke ist übrigens nicht neu, aber immer noch aktuell.) […]
[…] Vorgaben. Ihre Maßgaben zu befolgen hat in der Realität allerdings häufiger etwas mit Idealismus zu tun. Denn wenn unser Ziel klar, die Zeit für dessen Erreichen aber (zu) knapp bemessen oder der […]